Die Befreiung der Arbeiterklasse muss das Werk der Arbeiter selbst sein!
Arbeiterstimme
Zeitschrift für marxistische Theorie und Praxis
Literaturtipp
Der spanische Bürgerkrieg
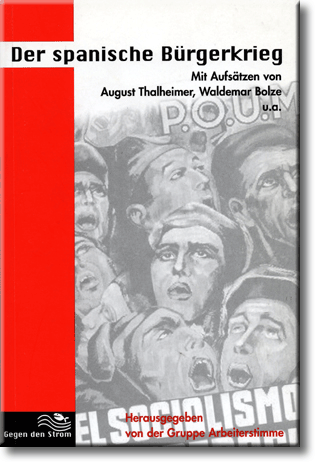
Die Niederlage der spanischen Republik 1939 war eine Niederlage für die spanische und internationale Arbeiterbewegung und ist bis heute Thema ungezählter Bücher.
Die Aufsätze in dem vorliegenden Buch sind erstmalig in der Arbeiterstimme in den Ausgaben September 1986 bis Oktober 1987 veröffentlicht und später in einer Broschüre zusammengefasst worden.
gehalten bei der Beerdigung unseres Genossen Hans Steiger
Werte Trauernde,
Am 15. November starb unser Genosse Hans Steiger in Nürnberg. Er war Mitgründer der Gruppe Arbeiterstimme und damit der letzte seiner Generation in unseren Reihen.
Hans hat die vielen Brüche des 20. und des beginnenden 21.Jahrhunderts in der deutschen Geschichte miterlebt. Den Faschismus, der sein junges Leben in den Jahren des Hungers und der Bomben bedrohte, und die sogenannten Wirtschaftswunderjahre, in denen die meisten Menschen von der Politik nichts mehr wissen wollten – es ging ja aufwärts, auch bei den Tätern, ohne die ein so umfassendes Menschheitsverbrechen nicht möglich gewesen wäre. Den Aufbruch der Jahre um 1968, die das Versprechen abgaben, dass eine andere Politik durchsetzbar wird, mit anderen gesellschaftlichen und persönlichen Freiheiten und einem anderen, unbelasteten Personal und die Restriktionen der späteren 1970er Jahre mit ihrer bleiernen Zeit und den Berufsverboten.
Die Verschärfung der militärischen Spannungen im Europa der 1980er und das Ende der sozialistischen Staatenwelt, inklusive der Sowjetunion.
Hans, wie uns alle in der Gruppe Arbeiterstimme, hat dieses Ende sehr getroffen, auch wenn wir dem existierenden Sozialismus stets kritisch, aber auch solidarisch gegenüberstanden. Wir wussten immer von den unzureichenden Voraussetzungen nach dem Weltkrieg, um ein antikapitalistisches System aufzubauen und waren doch erschüttert, als die Staaten nacheinander implodierten. Ich erinnere mich, dass Hans, inmitten des politischen Desasters, seiner Befriedigung Ausdruck gab, dass dieses Ende eines Staatensystems weitgehend unblutig verlief. Welchen Wert diese Tatsache hatte, mussten wir ohne weltgeschichtliche Pause zuerst außerhalb Europas, bald aber auch in Europa selbst miterleben. Den äußerst blutigen Krieg um Kuweit und die US-Invasion im Irak, die Sezessionskriege in Jugoslawien, das in blutige Stücke gerissen wurde, den NATO-Krieg gegen Serbien, in dem auch die Bundeswehr aktiv war.
Uns Jüngeren, die wir zwar die Fakten kannten, aber kein Erleben damit verbinden mussten, gelang es leichter, Distanz zu bewahren. Hans hatte es da viel schwerer, alle Kriege und Katastrophen wirkten nochmals so bedrückend, weil sie auf den Resonanzboden seiner Kindheits- und Jugenderinnerungen trafen.
Trotz alledem oder gerade deswegen: Hans war davon überzeugt, dass sich der Kampf für eine bessere, eine sozialistische Zukunft lohnen wird. Dafür trat er bereits als junger Erwachsener ein: zuerst in der Bewegung gegen die Wiederbewaffnung, dann in der Arbeiterbewegung. Seine Hinwendung zum Sozialismus erfolgte in der Gruppe Arbeiterpolitik, wo er mit Genossinnen und Genossen Kontakt bekam, die seit langer Zeit politische Erfahrung hatten. Die für ihre Überzeugungen Verfolgung, Haft und Exil erleiden mussten und die ihn prägten. Er schärfte seine Überzeugungen in vielen Diskussionen und Aktionen. Mit Schulungsabenden und im Selbststudium gewann er neues Wissen und größere Sicherheit bei der Beurteilung gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen. Daraus resultierte auch seine Herangehensweise an Probleme, seine Art zu diskutieren und vor allem seine typische Zähigkeit, wenn er Ziele verfolgte.
Zu Beginn der 1970er Jahre wagte er mit einigen Genossen der alten Gruppe einen Neuanfang mit der Gruppe Arbeiterstimme, deren Mitgründer er war. Man war auseinandergegangen, weil die politischen Differenzen nicht mehr anders zu überbrücken waren. Die Aufgaben mit dem Aufbau einer neuen Stimme im linken Lager waren vielfältig und sicher sehr belastend. Neben der Festigung der eigenen Gruppe in Diskussionen und Auseinandersetzungen wollte man nach außen wirken. Die Gruppe gab eine eigene Vierteljahreszeitschrift, die gleichnamige Arbeiterstimme, heraus. Über lange Zeit prägten seine Artikel das Bild in der Öffentlichkeit. Entlastung bekam er erst, als die jüngere Generation stärker Verantwortung übernehmen konnte.
Sein über viele Jahre gewonnenes Wissen, seine unschätzbare Erfahrung und sein nimmermüder Einsatz für eine bessere, eine sozialistische Zukunft prägten unsere Gruppe nicht nur über die Jahrzehnte, sondern halfen uns, Rückschläge und Enttäuschungen, die unsere Arbeit begleiteten, zu analysieren und in produktiver Weise umzusetzen. Seine Art, den Menschen zugewandt zu sein und zu bleiben, war für uns und unsere politische Reifung essenziell. Diskussionen und Auseinandersetzungen, die in der Sache auch hart sein konnten, führten nicht zur persönlichen Verletzung. Auch wenn sich die politischen Wege trennten, konnte man sich immer noch ins Gesicht sehen. Der tiefe, gelebte Humanismus, der so stark mit seinen Kindheits- und Jugenderfahrungen im und nach dem Krieg zu tun hatte, war uns Anschauung und Vorbild zur gleichen Zeit.
Wir werden ihn nicht vergessen.

Aus der Geschichte der Gruppe Arbeiterstimme
Rückblick auf 50 Jahre:
Die erste „Arbeiterstimme“ erschien am 30. Mai 1971. Die Gründung der „Gruppe Arbeiterstimme“ erfolgte am 21. November 1971 bei einer Vereinigungskonferenz der Gruppe Arbeiterpolitik Nürnberg mit der Gruppe „Unser Weg“ auf einer Konferenz in Frankfurt, an der auch Genossinnen und Genossen aus anderen Regionen teilnahmen. An der Gründungsversammlung nahmen 19 Genossinnen und Genossen teil und die Beschlüsse wurden ohne Gegenstimme angenommen. Alle Altersgruppen waren vertreten, vom ehemaligen KPO-Abgeordneten des preußischen Landtags, Alfred Schmidt, dem Redakteur von „Unser Weg“, Hermann Jahn, von Isi Abusch bis zu den Jüngeren aus der Nürnberger IG-Metall-Jugend, aus der Arpo Nürnberg auch Hans Kunz und Hans Steiger, die alles organisiert hatten. Einige aus der Nürnberger Gruppe konnten nicht teilnehmen. Der theoretisch und historisch beschlagene Genosse Udo Winkel war dabei sowie Schorse Stockmann, der Gewerkschaftsfunktionär aus Bremen, dem nach dem Krieg die Leitung der Bremer Gruppe Arbeiterpolitik zusammen mit Heinz Kundel oblag.
Zurück zu den Wurzeln: Der Werdegang der Gruppe und deren Zustand wurden wesentlich mitbestimmt von den politischen Entwicklungen in Deutschland und der Welt und von den Bewegungen, die dadurch entstanden, auch wenn diese wieder niedergingen. So haben die Gruppen, die die Arsti gründeten, auch später insgesamt vier Phasen, wie ich meine, durchschritten und durchlitten, meist in der Reihenfolge: mühsamer Aufbau – Konsolidierung – politische Enttäuschungen – Spaltungen – schwieriger Neuanfang. Der kleine Zirkel in der Wohnung von Hans Kunz, in der die Sitzungen stattfanden, umfasste anfangs meist nicht viel mehr als zehn Personen; später waren es nicht selten 28. Bei Jahreskonferenzen war die Zahl der Teilnehmenden höher, 50 bis 60, 1971 in der Wörlmühle Erlangen sogar 74.
Die Gruppe Arbeiterstimme ist eine kleine kommunistische Gruppe, die 1971 aus der Gruppe Arbeiterpolitik hervorgegangen ist. Zentrum und Redaktionssitz sind Nürnberg. Die Gruppe gibt die vierteljährlich erscheinende Zeitschrift „Arbeiterstimme“ heraus. Die Gruppe Arbeiterstimme sieht sich – ebenso wie die Gruppe Arbeiterpolitik – in der Tradition der Kommunistischen Partei Opposition (KPD-O) der Weimarer Zeit. Diese entstand 1928/29 als Opposition gegen die ultralinke Politik der KPD unter der Thälmann-Führung. Die führenden Politiker und Theoretiker waren Brandler und Thalheimer, die die Einheitsfrontpolitik vertraten, während die KPD die RGO-Politik praktizierte und mit Stalins verhängnisvoller „Sozialfaschismustheorie“ die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung zementierte und damit ihre kampflose Niederlage gegen die Nazis mitverursachte.
Die Spaltung geschah im Zusammenhang mit der europäischen Krise im September 1938, die zum Münchener Abkommen zwischen den Westmächten England/Frankreich und den Achsenmächten Deutschland/Italien führte. Die Krise hatte die Welt an den Abgrund eines allgemeinen Krieges geführt. Sein Ausbruch wurde durch die Kompromißbereitschaft der Westmächte verhindert, eine Kompromißbereitschaft, die Hitlerdeutschland zum Vorteil gereichte. Sie resultierte in der Besetzung des Sudetenlandes und später in der der gesamten Tschechoslowakei.
Die Frage, ob der Frieden in der 2. Septemberhälfte wirklich bedroht war, gab den Anlaß zu den Auseinandersetzungen im AK und im Anschluß daran in der KPO-Emigration Frankreichs. Über den Verlauf der Auseinandersetzungen hat das AK im Oktober 1938 eine Dokumentation mit dem Titel „Material zu den letzten innerparteilichen Vorgängen“ herausgegeben. Dort sind die KPO-Mitglieder mit ihren Vornamen oder Decknamen angegeben. In vorliegender Schrift sind sie des besseren Verständnisses wegen mit ihren Nachnamen angegeben. Die im „Material“ erwähnten Artikel sind von A. Thalheimer verfaßt, im Einverständnis mit H. Brandler. Um Mißdeutungen vorzubeugen, erfolgt die Namensnennung Brandler/Thalheimer.
Im abschließenden Abschnitt hat sich der Verfasser auf eine Deutung der damaligen Auseinandersetzungen versucht, die zur Spaltung der KPO-Emigration führte.
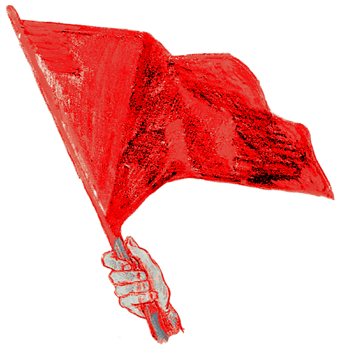
Normalerweise sind 40 Jahre eine lange Zeit und eigentlich Grund zum Feiern. Bei einer politischen Gruppe, die sich bestimmte Ziele gesetzt hatte, ist das jedoch etwas Zwiespältiges. Einerseits ist es schon bedeutsam, so lange durchgehalten zu haben, über alle Zeitereignisse hinweg – zuerst mit Hoffnungen und dann mit schweren Enttäuschungen. Da liegen tausende Stunden Arbeit hinter manchem von uns, oft endlose Diskussionen, Streit und Demonstrationen. Wenn andere ihrem Vergnügen nachgingen, stand für uns die Aufgabe, uns zu informieren, Papiere zu studieren und Analysen zu erstellen. So kamen in den vier Jahrzehnten auch über 160 Ausgaben der Arbeiterstimme zustande. Sie mussten auch immer wieder gestaltet, verschickt und verkauft werden; nicht eine Nummer ist ausgefallen. Auf der anderen Seite waren die Verhältnisse nicht so, dass wir die gestellten Ziele annähernd erreichen konnten, im Gegenteil. Wir konnten so unsere Kleinheit und die Schwächen nicht überwinden. Eine ganze Generation von Mitgliedern ist in dieser Zeitspanne verstorben. Unser Wirken sollte ja auch dahin führen, die Voraussetzungen zu schaffen, um in etwas Größerem, Gemeinsamen aufzugehen – eben, uns als Gruppe überflüssig zu machen.

Unerwartet kam die schlimme Nachricht: Unser langjähriger Freund und Genosse Peter Eberlen ist am 23. August 2009 im Alter von 70 Jahren in München verstorben. Wir waren überrascht und schockiert, hatten wir doch zusammen noch viel vor, was kurzfristige Pläne und langfristige Hoffnungen anbelangt. Peter war gerade dabei, sich an einer Reise nach China zu beteiligen, auch um auf der Jahreskonferenz der Gruppe darüber politische Schlussfolgerungen ziehen zu können. Peter wurde von der Krise des Kapitalismus, wie wir alle, in Atem gehalten und so hatte er erneut dem Drängen nachgegeben, für die Arbeiterstimme in einem Artikel dem Schwindel um die Bad Banks entgegenzutreten. Nun wird wieder einer fehlen, wenn Demonstrationen durch München ziehen, einer, der sich unzählige Male in seinem Leben schon engagiert hatte. Einer, auf den man zählen konnte, beim Kampf gegen die NATO-Kriegspolitik, bei den Auseinandersetzungen um die Rundfunkfreiheit und um das Versammlungsgesetz in Bayern; ganz zu schweigen von den gewerkschaftlichen Aktivitäten und von den Aktionen gegen sozialpolitische Streichungen. Als vor einiger Zeit die Einzelhandelskollegen im Tarifstreit in Bedrängnis kamen, trat er, obwohl in der IG Metall aktiv, an ihre Seite. Für Peter war es immer klar: Solidarität ist keine Einbahnstraße – und Solidarität kann nur im Kampf neu entstehen.