Die Befreiung der Arbeiterklasse muss das Werk der Arbeiter selbst sein!
Arbeiterstimme
Zeitschrift für marxistische Theorie und Praxis
Literaturtipp
Der spanische Bürgerkrieg
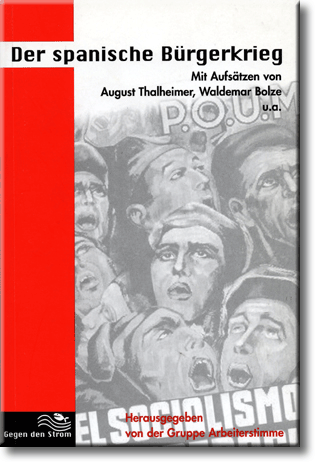
Die Niederlage der spanischen Republik 1939 war eine Niederlage für die spanische und internationale Arbeiterbewegung und ist bis heute Thema ungezählter Bücher.
Die Aufsätze in dem vorliegenden Buch sind erstmalig in der Arbeiterstimme in den Ausgaben September 1986 bis Oktober 1987 veröffentlicht und später in einer Broschüre zusammengefasst worden.
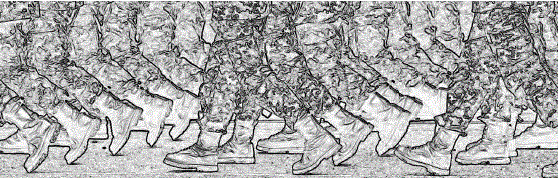
Deutschland nach der Zeitenwende (3)
Der Herbst der Reformen: Weniger Bürgergeld und mehr Soldaten
Nein, die Stimmung hat sich nicht gebessert. Selbst wenn beide Regierungsblöcke nichts sein wollten als konstruktiv und zusammenarbeitswillig, es kommt halt doch immer wieder was dazwischen. Mal ist es eine Richterin, die es auf dem SPD-Ticket zur Verfassungsrichterin schaffen will und dann unsanft von der CDU/CSU aus dem Rennen genommen wird, mal ist es der blöde Koalitionsvertrag, in dem kein Wort über mögliche Reichensteuern steht. Und die CDU, besonders aber die CSU lassen nicht mit sich reden, wer hätte das gedacht. Die SPD offenbar nicht.
Die politische Stimmung drückt sich zwischen den Wahlen meist in Umfragen aus. Sie stellen immer eine Momentaufnahme dar und geben eher Auskunft über die Befindlichkeit der Befragten als über das Regierungshandeln. Sie sind kein exakter Gratmesser, trotzdem wird aus ihren Ergebnissen manchmal, vor allem bei längerfristigen Trends, Politik. Das „Zeugnis“, das Kanzler Merz in der INSA-Umfrage Ende September 2025 ausgestellt wurde, ist weit weg von der Aufbruchsstimmung, die regierungsseitig so gerne beschworen wird. Seit dem relativen Tiefpunkt Anfang Juni mit 45% der Befragten steigt die Unzufriedenheit kontinuierlich auf inzwischen 65% an, die Entsprechung bei der Sonntagsfrage sieht die Union bei 25%, die SPD schneidet virtuell ebenfalls schlechter ab als bei den Wahlen im Februar. Was den politischen Druck erhöht, ist die Annahme, dass die AfD ihr Wählerpotenzial immer noch nicht ausgeschöpft hat. Die 26% der Umfrage liegen erkennbar deutlich über den knapp 21% bei der Bundestagswahl. Die Kommunalwahlen in NRW sprechen zumindest nicht gegen diesen Befund, auch wenn die AfD kein Oberbürgermeisteramt im Westen erreichen konnte. Die Partei kann warten, ihre WählerInnen bleiben ihr gewogen.
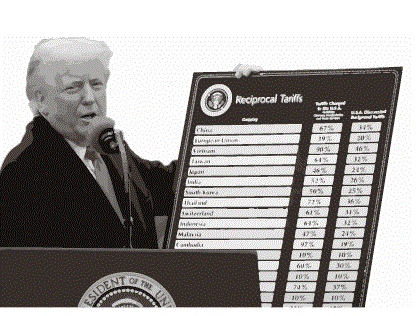
Trump, die Ökonomie und die Zölle
Seit seinem Amtsantritt zur zweiten Präsidentschaft ist Donald Trump dabei, einschneidende Korrekturen an der bisherigen Politik der USA umzusetzen, mit am spektakulärsten bei der Zollpolitik. Meistens geschieht das in typischer Trump-Manier, mit radikalen Ankündigungen, deren baldige Aussetzung, Verhandlungen über Deals, begleitet von neuen Drohungen usw.. Diese Politik wird oft als erratisch und chaotisch bezeichnet, eine Kennzeichnung, die durchaus ihre Berechtigung hat. In den hiesigen Medien liest man häufig Wortmeldungen von Ökonomen, die erklären, wie schädlich die Zölle für die Weltwirtschaft wären, auch den Amerikanern selbst würden sie keineswegs nützen. Dieser Kritik kann man, zumindest in vielen Fällen, eine Berechtigung nicht absprechen.
Trumps Politik ist sicher nicht frei von Widersprüchen und er handelt nicht kohärent im Sinne einer ökonomischen Schule. Trotzdem folgt das Agieren Trumps einer Logik und basiert auf einer Interpretation der US-amerikanischen Interessen. Das soll im folgenden aufgezeigt werden.
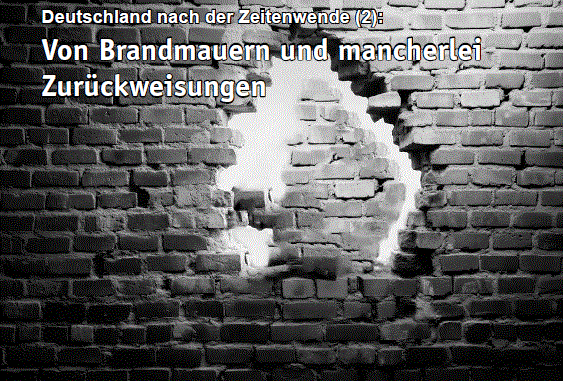
Deutschland nach der Zeitenwende
Wir haben uns in den letzten beiden Jahren verstärkt mit der veränderten und sich weiter verändernden politischen Situation in Deutschland auseinandergesetzt. Dabei waren wir im Herbst 2024 zum Schluss gekommen, dass das Gesellschaftsmodell der Bundesrepublik nicht nur in eine Krise geraten ist. Es ist im Begriff, auf vielen Ebenen mit den bisherigen Regeln zu brechen und das Verhältnis der Klassen zueinander sowie die Rolle, die der Staat innehatte, der sich bisher auch als Sozialstaat definierte, neu zu justieren. Dies betrifft alle Institutionen staatlicher Organisation genauso wie etwa das Parteienspektrum, seine Akzeptanz bei der Wählerschaft und - erst einmal als wenig systematischer Reflex – die Programmatiken der Parteien selbst.
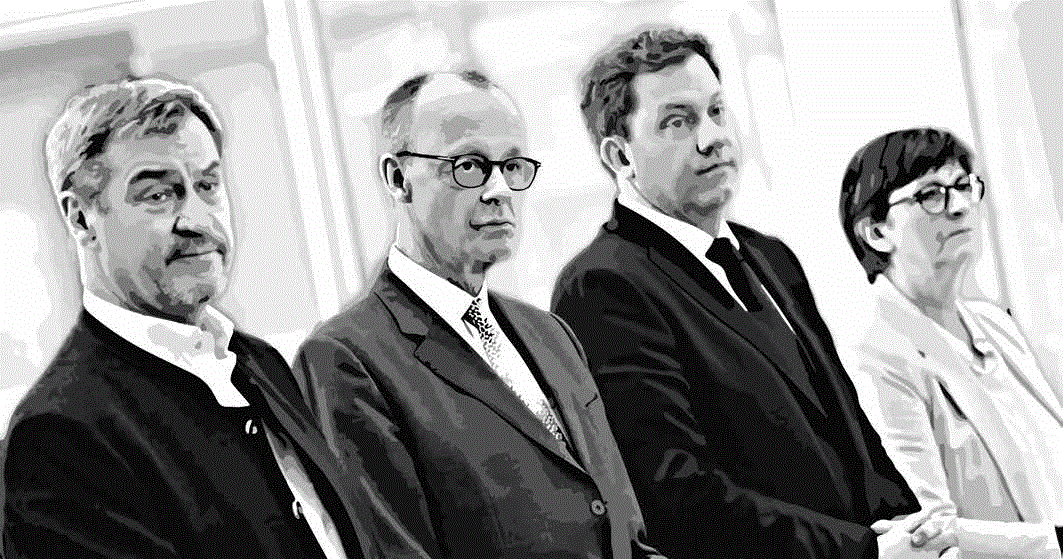
Nach der Bundestagswahl
Der letzte Ausweg der „bürgerlichen Mitte“: Schwarz-Rot plus neue Schulden ohne Bremse
Knapp vier Wochen vor der Wahl hat Friedrich Merz einen Vorstoß zur Migrationsfrage gestartet. Mit Verweis auf die stattgefundenen Anschläge behauptete er, jetzt müsse sofort gehandelt werden, eine Schließung der Grenzen und die Zurückweisung aller Menschen ohne gültige Einreisepapiere sei unbedingt notwendig. Ihm sei es völlig egal, wer diesem Vorschlag zustimme, wenn nur endlich das Richtige entschlossen angepackt würde. Konkret bestand das Handeln der Unionsfraktion darin, einen Entschließungsantrag und einen bisher in den Ausschüssen behandelten Gesetzesentwurf zur Abstimmung in den Bundestag einzubringen. Der Entschließungsantrag fand mit Hilfe der Stimmen der AfD eine Mehrheit im Bundestag, das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz jedoch nicht, obwohl auch hier die AfD zusammen mit den Unionsparteien stimmte. Auch FDP und BSW stimmten mehrheitlich dem Gesetz zu. Die Mehrheit im Bundestag wurde aber verfehlt, weil es aus der FDP zwei Gegenstimmen und fünf Enthaltungen gab und 16 Abgeordnete von der FDP, 12 von CDU/CSU und drei vom BSW nicht an der Abstimmung teilnahmen. Einige Abgeordnete blieben vermutlich aus politischen Gründen der Abstimmung fern.

Die Ampelkoalition platzt – eine vorgezogene Bundestagswahl soll's richten
Die Probleme in der Ampelkoalition waren seit langem unübersehbar. Ständig und ausführlich wurde in den Medien über die internen Differenzen und Streitereien berichtet. Von Umfrage zu Umfrage schmolz die Zufriedenheit der Wähler mit der Koalition. Wie inzwischen bekannt wurde, haben alle an der Ampel beteiligten Parteien im Vorfeld intern über ein mögliches Ende der Koalition nachgedacht, ohne aber gleich in dieser Richtung aktiv zu werden. Der Grund für das Zögern ist ein einfacher. Aus Sicht der drei Koalitionsparteien fehlte es schlicht und einfach an attraktiven oder zumindest akzeptablen Alternativen, um dafür das Risiko des Koalitionsbruchs einzugehen.
Nach den für sie katastrophalen Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg kam die FDP anscheinend zu einer neuen Beurteilung der Lage. Ein „Weiter so“ in der Regierung bringe für sie nichts mehr und würde ihre Aussichten bei der spätestens im Herbst 2025 fälligen Bundestagswahl nur noch weiter verschlechtern, so die neue Einschätzung. Deshalb begann die FDP gezielt auf das Koalitionsende hinzuarbeiten. Dabei wollte sie sich nochmals als entschlossene Hüterin von Haushaltsdisziplin und Schuldenbremse in Szene setzen, um damit bei ihrem potenziellen Anhang zu punkten.
Weiterlesen: Die Ampelkoalition platzt – eine vorgezogene Bundestagswahl soll's richten
Seite 1 von 7