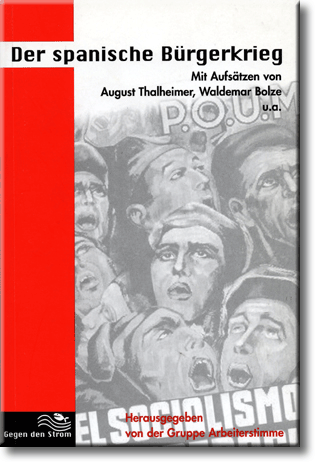Die Partei Die Linke ist bei der Bundestagswahl 2021 gerade noch einmal an einer kompletten Katastrophe vorbeigeschrammt. Mit dem Ergebnis von 4,9 Prozent wäre sie an der 5 %-Hürde gescheitert, hätten nicht drei Direktmandate den Schaden begrenzt und ihr den Einzug in den Bundestag in Fraktionsstärke gesichert. Ihr Stimmenanteil hat sich gegenüber der letzten Bundestagswahl fast halbiert. In Westdeutschland erhielt sie noch 3,6 % gegenüber 7,2 % 2017. In Ostdeutschland votierten 10,1 % für die Linke gegenüber 17,3 % bei den letzten Bundestagswahlen. Bei Gewerkschafter:innen kommt Die Linke bei 5,2% Verlusten auf 6,6%. Sie liegt auch hier hinter der AfD mit 12,2 %
Die Linke hat 640.000 Stimmen an die SPD und 480.000 Stimmen an die Grünen verloren. 320.000 ihrer ehemalige Wähler:innen haben gar nicht gewählt. Bei den Erstwähler:innen konnte Die Linke kaum punkten, Favoriten bei dieser Wähler:innengruppe waren Grüne und FDP.
Die „Aufarbeitung“
Gleich noch am Wahlabend machten sich manche Linkenpolitiker:innen auf die Suche nach den Gründen für das Wahldesaster, von Janine Wissler als einen Blick „tief in den Abgrund“ kommentiert.
Kurz nach der Wahl standen dabei gegenseitige Schuldzuweisungen einzelner Personen, Gruppen oder Strömungen im Vordergrund. Von einer inhaltlichen und konstruktiven Aufarbeitung der Misere, die an die Wurzeln geht, war da noch nicht allzu viel zu verzeichnen. Die neuen Streitlinien innerhalb der Partei waren die alten geblieben, nur mit dem Unterschied, dass jetzt die jeweils anderen für das Wahldesaster verantwortlich gemacht wurden.
Der Thüringer Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff twitterte, dass „das Wahlergebnis nicht das Resultat eines verfehlten Wahlkampfes“ sei, sondern „einer seit Jahren verschleppten strategischen Entscheidung, als sozialistische Partei klar für einen progressiven Gestaltungsanspruch in Regierungsverantwortung zu stehen“. Im Klartext: Die politisch-programmatische Zurichtung der Partei für „Rot-Grün-Rot“ im Bund hätte viel früher und noch viel rigoroser erfolgen müssen und Co-Chefin Henning-Welsow verkündete noch nach den ersten Prognosen am Sonntag, dass „Die Linke weiter für eine Regierungsbildung zur Verfügung“ stehe.
Im Folgenden sollen einige Aussagen von verschiedenen Gruppen oder wichtigen Personen einen Einblick in den Stand der anfänglichen „Aufarbeitung“ geben.
Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler weist Sahra Wagenknecht eine große Schuld an dem Ergebnis zu, die u.a. mit der Aufstehen-Bewegung eine Art Sektierertum der 70er Jahre betreibe und wirft ihr vor, „vielleicht sogar mit offener organisatorischer Separierung oder gar Spaltung zu liebäugeln“. In ihrem Buch „Die Selbstgerechten“ sieht er eine Kritik des Kurses der verbindenden Klassenpolitik und der Wahlprogrammatik der Linken. Der Auseinandersetzung darüber schreibt Schindler den Verlust der Linken von ein bis zwei Prozentpunkten zu.
Migrantische Politiker fordern in einem offenen Brief (01.10.2021) die Auseinandersetzung mit den Positionen von Sahra Wagenknecht zu führen, denn „ihr inhaltliches Projekt und das ihrer Anhänger:innen ist rückschrittlich und zum Scheitern verurteilt.“ Sie machen Wagenknecht verantwortlich für „die massive Zerrissenheit in vielen Landesverbänden, für Parteiaustritte und [sie sei] der Grund, warum viele engagierte junge Menschen, die wir so dringend brauchen, nicht zu uns kommen“. „Das Projekt „Aufstehen“ hat DIE LINKE über zwei Jahre beschäftigt und zur Spaltung und Lähmung der Partei beigetragen, zur Demobilisierung an der Basis und den dringend nötigen Parteiaufbau in Ost und West verhindert … Inhaltlich spalten die Thesen Wagenknechts unsere Wähler:innen in Lifestyle-Linke und hart arbeitende normale Menschen.“ Sie sehen „mit großer Sorge die Forderung von einigen Mandatsträger:innen, Sahra Wagenknecht wieder zurück in wichtige Ämter zu heben.“
Die Sozialistische Linke betrachtet das in ihrer Wahlanalyse andersherum: „ (…) der öffentlich ausgetragene Konflikt der letzten Jahre mit und um Sahra Wagenknecht, der vor allem viele Sympathisant:innen irritiert und uns schwer geschadet hat. Dabei sehen wir, dass Sahras Äußerungen und Publikationen zur Zuspitzung der Konflikte beigetragen haben und dass es eine Teilgruppe von Wähler:innen gibt, die deswegen DIE LINKE nicht gewählt haben. Dennoch gilt unseres Erachtens für die Gesamtbevölkerung, dass Sahra in einer herausgehobenen Position uns mit Sicherheit mehr Stimmen gebracht als sie uns auf der anderen Seite gekostet hätte.“
Sahra Wagenknecht und ihre Anhänger:innenschaft versuchten sich nach der Wahl in anderen Erklärungen: Das Scheitern liege an der mangelnden Bereitschaft der Partei, auf sie und ihre Thesen zu hören. Die beschlossene liberale Migrationspolitik, unsere Klimaschutzpolitik oder Genderfragen seien schuld. Die Linke hat sich zu wenig um das Thema soziale Gerechtigkeit gekümmert.
Weil die Diskussion um die Person Sahra Wagenknecht so emotionalisiert in den Vordergrund gerückt wird, besteht natürlich die Gefahr, dass die eigentliche Problematik auf der Strecke bleibt.
Nachdem der erste Schock überwunden war, nahmen die Bemühungen um eine vorwärtsweisende Aufarbeitung zu. Auf allzu platte Schuldzuweisungen an das eine oder andere Lager wurde verzichtet und der Versuch gestartet, die Streitpunkte herauszuarbeiten, ohne sich dabei in Polemik und Schuldzuweisung zu verlieren. Es zeichnet sich das Bestreben ab, die Partei zu einen und inhaltlich voranzubringen. Einen Einblick in die Diskussion geben die Beiträge u.a. von Klaus Dörre, Bernd Riexinger und Jule Nagel, die auf der Homepage der Linken nachzulesen sind. (dazu später mehr)
Gründe für den Absturz, …
… sind nicht nur in den parteiinternen Auseinandersetzung innerhalb der Linken zu suchen, sondern hauptsächlich in der Befindlichkeit und im Bewusstseinsstand der Wähler:innen. Viele wollten bei der Wahl politisch „gestalten“. Sie wollten einen Kanzler wählen, von dem sie sich eine etwas sozialere Politik erwarteten. Dazu genügte das Blinken der SPD nach links mit 12 € Mindestlohn und ähnlichem, aber in der Hauptsache wählten sie die Fortsetzung der Merkelschen Politik, die sie seit 16 Jahren kannten und mit der sie ja vermeintlich gut gefahren waren. Dafür stand für sie Olaf Scholz. Diese Kontinuität hätte R2G in ihren Augen nicht gewährleistet und deswegen kam für diese Gruppen die Wahl der Linken nicht in Frage. Eine Pelzwäsche, ohne sich nass zu machen.
Auch das Parteiausschlussverfahren gegen Sarah Wagenknecht im laufenden Wahlkampf hat Wähler:innen abgeschreckt, war es doch ein Zeichen für die Zerstrittenheit der Partei.
In Sachen Corona trug Die Linke die Regierungsmaßnahmen nahezu kommentarlos mit, nichts wurde in Frage gestellt, es gab keine Opposition. Die Eingriffe in die bürgerlichen Freiheiten und die teilweisen grundgesetzwidrigen Maßnahmen wurden geduldet. Die Genoss:innen, die hier anderer, abweichender Meinung waren, wurden angeprangert, da schwebte das Damoklesschwert Querdenker förmlich in der Luft. Von den anderen erwartete man es ja nicht, aber dass auch Die Linke in die obrigkeitsstaatliche Parole „Ich kenne keine Parteien mehr“ miteinstimmte, hat sicherlich auch potentielle Wähler:innen abgehalten.
Die coronabedingt späte Wahl der neuen Parteivorsitzenden Jasmin Wissler und Hennig- Welsow hat ihnen den Wahlkampf erschwert, obwohl sich beide gut geschlagen haben und sie immer versucht haben, linke Inhalte deutlich zu machen.
Die Medien spielten in diesem Wahlkampf mit eine entscheidende Rolle. Das Wahlprogramm der Linken, mit Abstand das sozialste, klimaverträglichste und friedlichste, das auf dem Programmmarkt war, wurde nahezu nicht erwähnt. Wenn über die Linke berichtet wurde, dann ging es um den Austritt aus der NATO. Auch innerparteiliche Konflikte wie z.B. der um Sahra Wagenknecht wurden immer begierig aufgegriffen und breitgetreten. Im Gegensatz dazu wurde der Lindnerpartei FDP wieder und wieder unverhohlen das Wort geredet. Die Medien hatten außerdem nahezu kritiklos die von den Unionsparteien und der FDP befeuerte Kampagne vor der linken, sozialistischen Gefahr transportiert und sich so zu deren Sprachrohr gemacht.
Die Signale, die Die Linke an SPD und Grüne in Bezug auf eine Regierungsbeteiligung aussandte, haben ein Übriges getan.
Das Schielen nach Regierungsbeteiligung
Über das Bestreben der Ex-Vorsitzenden Kipping, die Partei auf Regierungsbeteiligung R2G einzuschwören, haben wir schon berichtet (Arsti 211). Das führte im Wahlkampf zu einem Andienen an SPD und Grüne dergestalt, so dass keine fundamentale Kritik an deren Inhalten geübt wurde, um sie nicht zu verprellen. Es wurde sogar signalisiert, dass über den Austritt aus der NATO noch lange nicht das letzte Wort gesprochen sei. Immer wieder war zwischen den Zeilen zu lesen, dass die dazu im Parteiprogramm verankerten Positionen ja so unveränderlich auch nicht seien und, wenn nötig, über Bord geworfen werden könnten. Nach dem desaströsen Scheitern des „Krieges gegen den Terror“ in Afghanistan war die Linke nicht in der Lage, hier ihr Alleinstellungsmerkmal Friedenspolitik deutlich herauszuheben. Sie war die einzige Partei im Parlament, die den Krieg von Beginn an immer wieder angeprangert und dagegen Stellung bezogen hatte. Die Abstimmung über die katastrophale Evakuierung wurde benutzt, um der Linken eine verantwortungslose Haltung in die Schuhe zu schieben, obwohl es doch Union und SPD waren, die noch im Juni gemeinsam mit der AfD eine schnelle Evakuierung verhindert hatten. Auch das hat Die Linke Stimmen gekostet.
Wie weiter?
Direkt nach der Wahl hatte die Führung der Linken eine „bedingungslose Analyse gefordert und eine Neuaufstellung der Partei“ angekündigt. Die Analyse ist ins Laufen gekommen, und wird teilweise auf der Homepage der Linken veröffentlicht. Im Folgenden werden einige der Beiträge auszugsweise vorgestellt.
Vorweg noch die Überlegungen von Geschäftsführer Jörg Schindler zum Ausgang der Wahl: „Das Ergebnis ist die Höchststrafe, die es in der Politik gibt: Unter 5 Prozent bedeutet normalerweise politische Bedeutungslosigkeit, das ist die Todesstrafe für politische Parteien. Wir haben diese Strafe allerdings auf Bewährung erhalten und dürfen wegen drei Direktmandaten trotzdem als Fraktion im Bundestag vertreten bleiben. Ab jetzt haben wir vier Jahre Zeit zu zeigen, dass wir gesellschaftspolitischen Wert haben. Das ist unsere Bewährungsauflage. Eine Chance, die wir jetzt nutzen müssen. Sonst droht unausweichlich unser Tod.“
Wie könnte nun diese „Chance“ genutzt werden?
Bernd Riexinger: „Wir müssen auf unserem Kernfeld der sozialen Gerechtigkeit bleiben und es um die Klimagerechtigkeit erweitern. Wenn wir als DIE LINKE Lösungen für die verschiedenen miteinander verbundenen Krisen im Kapitalismus (Klimakrise, soziale und wirtschaftliche Krise, hegemoniale Krise) aufzeigen wollen, dann werden wir die Idee des sozial-ökologischen Systemwechsels weiterentwickeln und für unsere Außenwirkung prägend machen müssen. … Es besteht kein Grund, unsere Position zur NATO und zu Auslandseinsätzen aufzuweichen. Aber es besteht Bedarf an einer Verständigung über sinnvolle friedenspolitische Schwerpunkte. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Frage der Auflösung der NATO unter unseren Anhänger*innen umstritten ist, fast die Hälfte ist gegen einen Austritt. … Die Regierungsdebatte hat sich erst einmal erledigt. Wir machen jetzt vier Jahre Oppositionsarbeit. Wir brauchen auch die Debatten über den Sinn des Regierens nicht jedes Mal neu zu führen. Es ist weiterhin richtig, Regierungsfragen nicht nur an die Haltelinien zu binden (die verbindlich sind), sondern mit einem linken Reformprogramm zu verknüpfen. Also verbindliche politische Maßstäbe zu entwickeln, was wir mit einem Politikwechsel verbinden.“
Jule Nagel, Linken-Stadträtin in Leipzig und Mitglied des Sächsischen Landtages, spricht sich u.a. für eine Modernisierung der Außenpolitik aus: „Die Linke ist die einzige Partei, die einen dezidiert friedenspolitischen Standpunkt hat und neue außenpolitische Bündnisse fordert und auf zivile Konfliktlösungen und Abrüstung orientiert.
Die außen- und friedenspolitische Position der Linken muss allerdings dringend modernisiert und auf einen stringenten, glaubwürdigen Nenner gebracht werden. Das heißt, dass tradierter Antiimperialismus und die verstaubte Denke einer zur USA alternativen sozialistischen Gegenmacht, deren Protagonisten dann von Kritik weitestgehend ausgenommen werden, dringend einer Generalkritik unterzogen gehört.
Die Linke braucht eine Selbstjustierung, programmatisch, methodisch und strategisch. Faule innerparteiliche Kompromisse, wie sie die jüngere Geschichte der Linken prägen, und zu einem inkonsistenten Bild der Linken führen, dürfen diesen Prozess nicht prägen.
Wir sollten die Zeit nutzen. Es ist dringend und existentiell.“
Klaus Dörre hielt am 6. November ein Referat auf der Parteivorstandssitzung mit dem Titel: „Schicksalswahl: Alles muss anders werden, ändern soll sich wenig. Die Linke muss die Nachhaltigkeitsrevolution mit dem Sozialen verbinden.“ Dabei spricht sich Dörre für eine „Erneuerung der sozialistischen Utopie“ aus. „Dass Die Linke sich neu erfinden muss, ist ein schöner Satz. Die Frage ist nur, mit welchem Ziel. … Dies vor Augen, wird sich für die Linkspartei die Existenzfrage stellen. Als eigenständige politische Formation hat sie nur dann eine Zukunft, wenn sie – glaubwürdig und lebensnah – deutlich macht, dass eine Nachhaltigkeitsrevolution allenfalls erfolgreich sein kann, sofern mit der (ökonomisch-ökologischen) Zangenkrise zugleich der Kapitalismus überwunden wird. … Gut möglich, dass eine solche Linke auch an eingeschliffenen Parteigrenzen rüttelt, denn die alte Scheidelinie zwischen »reformistischer« und »revolutionärer« Linker ist unter den Bedingungen der Zangenkrise überflüssig. Sozialismus im 21. Jahrhundert ist ein gradueller Politikansatz. Alle Kräfte, die unter Bezeichnungen wie demokratische Postwachstumsgesellschaft, Gemeinwohlökonomie, Gesellschaft der Commons und so weiter nach einer Alternative zum Wachstumskapitalismus suchen, sind ihre natürlichen Verbündeten. Das unterscheidet eine sozialistische Formation von den systemaffirmativen Mehrheiten bei Grünen und SPD. In den Klimabewegungen, aber auch in den Gewerkschaften, den Umweltverbänden, bei antirassistischen und Frauenbewegungen kann ein ökologischer Sozialismus eine große Anhängerschaft finden. Darin, das zu erkennen, liegt die Chance, den Niedergang der Linkspartei zu einem produktiven Scheitern zu machen.“
Ekkehard Lieberam und Volker Külow haben ihre Kritik an der Linken in einem Artikel in der UZ (8.10.21) mit dem Titel „Wild nicht erlegt – dafür Flinte verloren“ zusammengefasst: „Als eine entschiedene Stütze des außerparlamentarischen Kampfes in den großen Bewegungen der vergangenen vier Jahre, im Kampf um bezahlbare Mieten, im Klimakampf ebenso wie beim Kampf der Prekären und Abgehängten um Lohn und Rente. … Die Linke hat versucht ihren Platz im Parteiensystem zu ändern. Sie hat sich von einer Partei der Opposition zur NATO und zum kapitalistischen System gewandelt zur „Regierungspartei im Wartestand“. Die Hauptschwäche in der bisherigen Diskussion innerhalb der Partei ist nach den Autoren „die Negierung der schon längst von marxistischen Köpfen wie Rosa Luxemburg und Wolfgang Abendroth gewonnenen Erkenntnisse über die politische Zähmung ehemals sozialistischer und systemoppositioneller Parteien mittels der außerordentlichen Integrationskraft der parlamentarischen Demokratie.“
So viel zur inhaltlichen Aufarbeitung. Bei der Neuaufstellung der Partei hat sich dagegen noch nicht viel getan. Die Bundestagsfraktion setzt mit der Wahl von Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch als Vorsitzende auf ein klares „Weiter so“. Die Mehrheit in der Fraktion besteht aus dem alten Hufeisenbündnis, gebildet von Reformern und dem linken Flügel, der Sahra Wagenknecht nahesteht. Der Parteivorstand wird dagegen von den eher aktivistisch ausgerichteten Bewegungslinken dominiert, Angehörige der Sozialistischen Linken, der Kommunistischen Plattform oder der BAG Hartz IV sowie von Cuba Si sind seit dem letzten Parteitag nicht mehr im Parteivorstand vertreten
Wie es um die Zusammenarbeit in der Fraktion bestellt ist, schätzt Katharina Dahme, Mitglied im Ko-Kreis der BAG Bewegungslinke, so ein: „Da gibt‘s eine ganze Reihe von Leuten, die jetzt den Bundesgeschäftsführer oder Parteivorsitzende abschießen wollen, aber bevor dann die Luft auch für die Fraktionsspitze dünner wird, verhält man sich lieber (erstmal!) ruhig, um die eigenen Posten nicht zu gefährden. Es droht also munter so weiterzugehen in der Fraktion, wie es aufgehört hat: mit dem Hufeisen. Auf der Strecke bleibt dabei die Partei.“ Sie spricht sich dezidiert für eine andere Diskussionskultur in der Partei aus, „… insbesondere eine Fehlerkultur, die uns – das wird nach diesem schlechten Wahlergebnis besonders deutlich – komplett abhanden gekommen zu sein scheint. Es wäre jetzt wichtig, über Kritik und Fehler zu reden, weil wir nur besser werden, wenn wir aus dem Wahlkampf etwas lernen.“
Mit den inhaltlichen Differenzen zwischen Parteivorstand und Fraktion konstruktiv umzugehen wird eine der ersten, immens wichtigen zukünftigen Aufgaben der Linken sein.
Eventuell bringt ja der Zwang zur Zusammenarbeit der unterschiedlichen Lager eine Einigung, denn drei Austritte aus der Fraktion würden dazu führen, dass Die Linke den Fraktionsstatus verliert. Angesichts der Aufgaben, die auf Die Linke nach ihrem Selbstverständnis als sozialistische Partei zukommen, eine Notwendigkeit!
In diesem Sinn muss die Partei Die Linke einen Weg zu einer Kultur der wechselseitige konstruktiven Kritik und einem solidarischen Umgang der Genoss:innen untereinander finden, ansonsten wird die Partei in der Politikunfähigkeit und damit Bedeutungslosigkeit enden. Das würde für alle linken Gruppen, Strömungen und Parteien in Deutschland einen herben Verlust bedeuten. Zum Schluss sei mit einem Auszug aus der Präambel des Parteiprogramms noch einmal daran erinnert, wofür Die Linke angetreten ist: „Wir haben uns zusammengeschlossen zu einer neuen politischen Kraft, die für Freiheit und Gleichheit steht, konsequent für Frieden kämpft, demokratisch und sozial ist, ökologisch und feministisch, offen und plural, streitbar und tolerant. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland, in Europa und weltweit, mit Gewerkschaften und Bewegungen suchen wir nach alternativen Lösungen und gesellschaftlichen Alternativen. Wir wollen eine Gesellschaft des demokratischen Sozialismus aufbauen, in der die wechselseitige Anerkennung der Freiheit und Gleichheit jeder und jedes Einzelnen zur Bedingung der solidarischen Entwicklung aller wird. Wir kämpfen für einen Richtungswechsel der Politik, der den Weg zu einer grundlegenden Umgestaltung der Gesellschaft öffnet, die den Kapitalismus überwindet.“
Dem ist nichts hinzuzufügen!