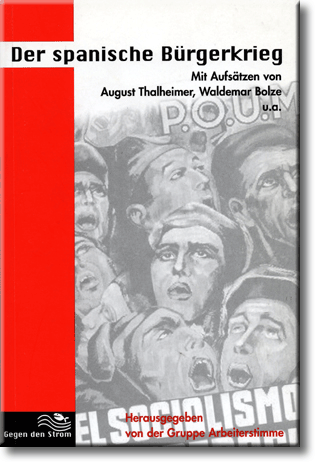Wenn wir das Erstarken der AfD analysieren wollen, müssen wir zuerst die Entwicklung der Wirtschaft in den vergangenen Jahren und Monaten betrachten und untersuchen.
Dabei stellen wir fest, dass sich die deutsche Industrie in der Krise befindet. Die Konzerne wälzen ihre Probleme auf die Belegschaften ab und setzen auf Massenentlassungen und Werksschließung. In den letzten Wochen verging kaum ein Tag, an dem nicht darüber berichtet wurde. Bei Konzernen, wie VW, Ford, Schäffler, Bosch, Thyssen-Krupp oder Continental; überall wird der Rotstift angesetzt und Arbeitsplätze werden vernichtet. Neben den großen Konzernen gibt es unzählige kleine und mittlere Unternehmen, über die weniger in den Medien zu finden ist, die aber parallel zur Entwicklung in der Großindustrie ebenfalls in großem Umfang Arbeitsplätze abbauen wollen. Das gilt überdurchschnittlich für ostdeutsche Betriebe.
Aber nicht nur in der Metallindustrie kriselt es. Auch andere Branchen, wie Chemie und Stahl, sind von der Krise betroffen.
Die Gründe der Krise sind vielfältig. Fast alle Branchen der industriellen Fertigung befinden sich in einem anhaltenden Transformationsprozess.
Ausgelöst wurde die Transformation durch die Klimakrise. Mithilfe einer umfassenden Dekarbonisierung soll diese nun abgemildert werden. Weitere Punkte sind die Digitalisierung der Produkte und Produktionsweisen (KI), sowie internationale Verwerfungen, hervorgerufen durch die Trump'sche Zollpolitik und die Kriege in der Ukraine und Israel. Auch die aktuelle Politik der Bundesregierung und der EU trägt nicht gerade dazu bei, dass sich die Krisensituation beruhigt.
Besonders stark von der Krise betroffen sind die Automobilindustrie und ihre Zulieferer. Der Absatz von deutschen E-Autos stagniert derzeit. Die Konkurrenz – insbesondere aus Asien und den USA – macht Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz auf den Weltmärkten Anteile streitig. Die Branche kämpft mit sinkenden Profiten und einem hohen Investitionsbedarf, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Lösen wollen die Vorstände der Konzerne die Probleme – wie immer – auf dem Rücken der Belegschaften.
So berichtete Ende des vergangenen Jahres der VW-Gesamtbetriebsrat, dass Volkswagen die Schließung von mindestens drei Werken in Deutschland plant und dass dadurch zehntausende Stellen wegfallen. Bei den verbleibenden Belegschaften soll außerdem der Lohn deutlich gekürzt werden.
Im Gespräch war auch das VW-Werk in Zwickau mit mehr als 10.000 Beschäftigten. In dem Werk werden heute ausschließlich E-Autos produziert. Aber selbst bei einem Fortbestand des Werkes würde den Plänen der Geschäftsführung zufolge in Zwickau künftig nur noch auf einer, statt auf zwei Fertigungslinien produziert. Entsprechend groß war die Empörung der KollegInnen. Und deren Mobilisierung. Die IG Metall rief zu Warnstreiks und Verhandlungen auf, die an allen Standorten massiv befolgt wurden.
Dadurch konnten unmittelbare Werksschließungen erst einmal abgewendet werden. Die Gewerkschaft erreichte das in Verhandlungen kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr.
Außerdem sind betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2030 ausgeschlossen. Die seit drei Jahrzehnten geltende Beschäftigungssicherung - die der Konzern im September 2024 aufgekündigt hatte - wird wieder in Kraft gesetzt und gilt nun bis 2030.
Gleichwohl soll in zwei VW-Werken die Produktion, so wie sie jetzt gestaltet ist, auf längere Sicht eingestellt werden: Dem Kompromiss zufolge ist vorgesehen, dass in Dresden Ende kommenden Jahres die Fahrzeugfertigung endet. Für die Zeit ab 2026 soll „ein alternatives Gesamtkonzept“ erarbeitet werden.
Zwar sollen alle Werke erhalten bleiben, aber bis 2030 werden insgesamt 35.000 Arbeitsplätze abgebaut.
Ein wirklicher Erfolg sieht anders aus .
So wie bei Volkswagen geht in vielen Betrieben bei den Beschäftigten die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust um. Das gilt besonders für die ostdeutschen Bundesländer. Hier fand in den 1990er Jahren eine von den Menschen traumatisch erlebte Deindustrialisierung statt, die sich nun zu wiederholen scheint.
Es waren die Hersteller und Zulieferer der Automobilindustrie, die sich qualifizierte Beschäftigte in den ehemaligen Werken der DDR-Autoindustrie sicherten. Der Schwerpunkt lag dabei in Sachsen. Allerdings haben alle dieser Unternehmen ihren Hauptsitz (eine Ausnahme bilden wenige Zulieferer) in Westdeutschland. In den ostdeutschen Betrieben findet nur die Produktion statt und im Westen fallen die Entscheidungen. Damit sind die Ostbetriebe die “verlängerten Werkbänke” der Konzerne.
Jeder vierte Arbeitsplatz in der Ost-Industrie hängt an der Branche der Automobilfertigung und ihrer Zulieferer. So kommt derzeit jedes zweite E-Auto aus dem Osten. Daher sind bei schrumpfenden Verkaufszahlen dort die Auswirkungen größer als im Westen.
Aber auch in anderen Branchen kriselt es heftig. Ein besonderer Fall ist die Stahlindustrie. Sie steckt tief in der Krise. Diese könnte sich noch verschärfen, wenn die exorbitanten US-Zölle die entsprechende Wirkung auf die Arbeitsplätze zeigen.
Nach Einschätzung der IG Metall ist die deutsche Stahlindustrie in ihrer Existenz bedroht. Als Grund wird die Billig-Konkurrenz aus China genannt, dazu kommen Belastungen aus dem EU-weiten Handel mit CO2-Zertifikaten.
Sollte die Stahlindustrie aufhören zu existieren, wären direkt 85.000 Arbeitsplätze bedroht. Auch für die weiterverarbeitende Industrie hätte das Folgen. Studien gehen von einer halben Million gefährdeter Arbeitsplätze aus.
Die zuständige Gewerkschaft IG Metall zeigt sich ratlos. So hat sie jetzt einem Lohnabschluss zugestimmt, der ab Januar 2026, bei einer Laufzeit von 15 Monaten, eine Lohnerhöhung von gerade einmal 1,5 Prozent bringt. Bei einer Inflationsrate von aktuell 2,4 Prozent bedeutet dieser Abschluss einen starken Reallohnverlust. Lohnverzicht sichert keine Arbeitsplätze. Das war in der Vergangenheit so und wird auch in der Zukunft so sein. Diese Erkenntnis wurde in der Vergangenheit von der IG Metall richtigerweise so propagiert. Nur scheint diese Erkenntnis an den führenden Köpfen der Gewerkschaft vorbeigegangen zu sein.
Aber nicht überall wütet die Krise. Bei manchen Konzernen besteht geradezu eine Goldgräberstimmung. Einer dieser Konzerne ist Rheinmetall. Dort wissen die Bosse geradezu nicht mehr “wohin mit den Profiten”. Der Waffenproduzent expandiert daher in allen Bereichen, die mit dem Krieg zu tun haben.
Es verwundert daher nicht, dass immer mehr Firmen Interesse am Rüstungsgeschäft zeigen und in diese Branche einsteigen wollen. Beratung und Vernetzungsangebote gibt es beim Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV). Die “junge Welt” berichtet, dass dieser Verband innerhalb eines Jahres seine Mitgliederzahl um ein Drittel, auf fast 400, erhöht hat. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen.
Auch zu dieser Entwicklung gibt es keine oppositionelle Haltung seitens der Gewerkschaften. Im Gegenteil!
Der DGB begreift die Aufrüstung und Kriegsinfrastruktur als Chance. Mit “konsumptiven Milliardeninvestitionen zur Stärkung der Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit” würden
“gute Arbeit und faire Löhne” (UZ, 10.10.2025) einhergehen.
Die Situation in vielen Betrieben ist also geprägt von der Angst der Menschen, möglicherweise den Arbeitsplatz zu verlieren. Aber das ist nur ein Teil der Stimmungslage. Hinzu kommen Wut und Enttäuschungen. Diese resultieren oft aus niedrigen Löhnen und Gehältern, aus Abstiegs- und Existenzängsten, sowie aus willkürlicher Behandlung und üblen Umgangsformen von und durch Vorgesetzte und Kapitaleignern. Ein Gefühl des “Abgehängtseins” macht sich breit und eine Wut auf “die da oben”.
Der Grund, warum in vielen Betrieben kaum mehr als der Mindestlohn – und manchmal nicht einmal der – bezahlt wird, liegt meist an der fehlenden Tarifbindung.
Schlechte Behandlung und Willkür gegenüber den Beschäftigten dagegen ist möglich, weil es keinen Betriebsrat gibt, der dagegen interveniert.
Bei der Tarifsituation sieht es folgendermaßen aus: Für rund 49 % der abhängig Beschäftigten war das Beschäftigungsverhältnis 2024 durch einen Tarifvertrag geregelt.
Allerdings gibt es Unterschiede zwischen den alten und neuen Bundesländern.
Für 43 % der. Beschäftigten in den alten Bundesländern war das Beschäftigungsverhältnis 2024 durch einen Branchentarifvertrag geregelt. Für 7 % dieser Beschäftigten galten Firmentarifverträge.
In den neuen Ländern war die Tarifvertragsbindung deutlich niedriger. Hier galten für 31 % der Beschäftigten Branchentarifverträge. 11 % arbeiteten in Unternehmen mit Firmentarifverträgen. (Statistisches Bundesamt)
Für 50% der Beschäftigten im Westen und 58 % der Arbeiter und Angestellten im Osten gab es keinen Tarifvertrag.
Neben der Tarifbindung verliert auch die betriebliche Mitbestimmung an Bedeutung. Immer weniger abhängig Beschäftigte arbeiten in Betrieben mit einem Betriebsrat.
Waren es im Westen Mitte der 1990er Jahre noch 51 Prozent der Beschäftigten, so sank der Wert auf heute 40 Prozent, im Osten sank er von 43 auf 33 Prozent.
Das ist eine dramatische Entwicklung. Die Mehrheit der abhängig Beschäftigten ist alleine und einzig der Unternehmermacht ausgesetzt und hat kaum Möglichkeiten, ihr Arbeitsumfeld im eigenen Interesse zu beeinflussen. So eingeschränkt die Möglichkeiten eines Betriebsrats auch sind, die Unternehmenspolitik mitzubestimmen, so hat er doch Arbeitsfelder, in denen er für seine KollegInnen etwas bewirken kann:
So bestimmt der Betriebsrat mit bei der Arbeitszeitgestaltung und den Entlohnungsgrundsätzen. Er kümmert sich um soziale Themen im Betrieb, um personelle Angelegenheiten, die Berufsbildung, den Gesundheitsschutz, die Arbeitsplatzgestaltung und um wirtschaftliche Angelegenheiten.
Über den Betriebsrat haben außerdem die Gewerkschaften Zugang in die Betriebe. Und alleine das ist schon fast die wichtigste Voraussetzung, dass sich eine Belegschaft die Tarifbindung erkämpfen kann.
Leider gibt es keine Anzeichen, dass die negative Entwicklung endet. Im Gegenteil. Es sind die Gewerkschaften, die mit ihrer Mitgliedschaft eine Veränderung zum Positiven erzwingen müssten. Aber auch sie werden schwächer. Die Mitgliederzahlen bei den Gewerkschaften sinken.
Die IG Metall zum Beispiel zählte 2.096.511 Mitglieder zum Jahreswechsel 2024/2025. Das entspricht einem Rückgang von 1,9 Prozent zum Vorjahr. Im Jahr 2018 hatte die IG Metall noch mehr als 2,27 Millionen Mitglieder. Seither sind die Zahlen stetig zurückgegangen.
An dem Punkt kommt die AfD ins Spiel. Von keiner Personengruppe wird die Partei stärker unterstützt als von der der Arbeiter. In Sachsen, Brandenburg und Thüringen wählten fast 50 Prozent der Arbeiterschaft die AfD.
Die Partei habe “sich als Arbeiterpartei etabliert”, heißt es in den Medien. Und tatsächlich wurden SPD und Die Linke von ihr abgelöst. Bei der letzten Bundestagswahl stimmten für die SPD 12 Prozent der Arbeiter, für Die Linke 8 Prozent und die AfD 38 Prozent
An dem Parteiprogramm der AfD kann es nicht liegen. Denn das ist eindeutig neoliberal. Die Partei will weder die Reichen stärker besteuern noch den Mindestlohn erhöhen.
Dafür bietet sie einen Sündenbock an, auf den sie viele Verwerfungen im Land zurückführt. Platt ausgedrückt funktioniert die AfD-Propaganda so: “Es sind die vielen “illegalen” Einwanderer, die Asylbewerber, die das Land überschwemmen, die hierher kommen, nicht arbeiten, viel Geld erhalten und dazu noch Deutsche mit Messern angreifen und umbringen”.
Ganz offensichtlich funktioniert Ausländerfeindlichkeit auch heute noch, um von den tatsächlichen Verursachern der Probleme abzulenken.
Und große Teile der Bevölkerung und insbesondere der Arbeiterklasse fallen auf sie herein.
Wie schon beschrieben, sind die Probleme und Nöte von Teilen der Arbeiterklasse sehr groß. Sie bestimmen das Denken und Verhalten dieser Menschen.
So wird das Angebot einer Partei gerne angenommen, die “nicht verbraucht” ist (die AfD hat noch nirgendwo mitregiert), die die Finger in offene Wunden legt, die für billige Energie aus Russland eintritt, die gegen den Ukrainekrieg ist und die von den Altparteien deshalb heftig angefeindet wird.
Mit der Wahl der AfD will man so den Altparteien eins auswischen, die als die wahren Verursacher ihrer Probleme und Miseren gesehen werden.
Dass das ein Irrtum ist, werden diese Teile der Arbeiterschaft früher oder später selbst bemerken.
Aber darauf kann man eigentlich nicht warten. Die Frage ist “Was tun?”
Wichtig wäre, dass sich die betrieblichen und gesellschaftlichen Veränderungen in einem neuen Klassenbewusstsein niederschlagen. Ein Weg dahin wäre, dass sich die Gewerkschaften in ihrer Politik mehr am Interessen- oder Klassengegensatz und weniger an der Sozialpartnerschaft orientieren würden. So hat zum Beispiel die IG Metall vor mehr als 20 Jahren das letzte Mal für Forderungen zu einem Flächentarifvertrag gestreikt.
Jeder, der schon einmal an einem Streik teilgenommen hat, kann davon berichten, wie sich das Denken und Verhalten der Teilnehmer verändert hat.
Natürlich kann man von Außen wenig zur Änderung der Politik der Gewerkschaften beitragen. Das muss von Innen, von den Kolleginnen und Kollegen, kommen. Die schärfer werdende Krise aber wird viele Möglichkeiten für kämpferische Auseinandersetzungen mit Konzernen und Politik bieten. Und oft werden die abhängig Beschäftigten dazu gezwungen sein. Beginnend mit der Forderung an die Bundesregierung nach einer effektiven Industriepolitik, zum Beispiel im Stahlbereich, bis hin zur Verhinderung von Massenentlassungen, Werksschließungen und Sozialabbau.