Die Befreiung der Arbeiterklasse muss das Werk der Arbeiter selbst sein!
Arbeiterstimme
Zeitschrift für marxistische Theorie und Praxis
Literaturtipp
Der spanische Bürgerkrieg
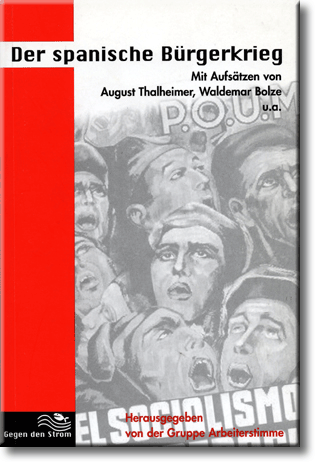
Die Niederlage der spanischen Republik 1939 war eine Niederlage für die spanische und internationale Arbeiterbewegung und ist bis heute Thema ungezählter Bücher.
Die Aufsätze in dem vorliegenden Buch sind erstmalig in der Arbeiterstimme in den Ausgaben September 1986 bis Oktober 1987 veröffentlicht und später in einer Broschüre zusammengefasst worden.
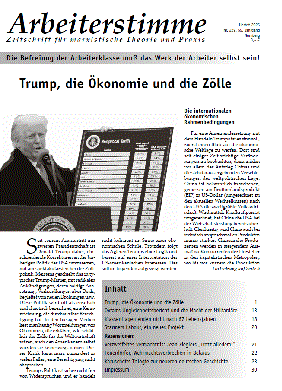
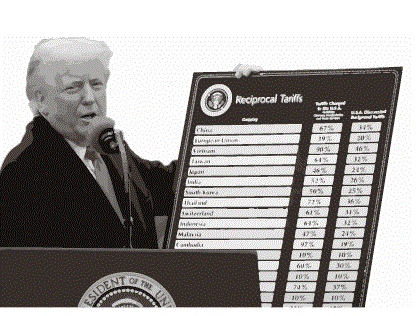
Trump, die Ökonomie und die Zölle
Seit seinem Amtsantritt zur zweiten Präsidentschaft ist Donald Trump dabei, einschneidende Korrekturen an der bisherigen Politik der USA umzusetzen, mit am spektakulärsten bei der Zollpolitik. Meistens geschieht das in typischer Trump-Manier, mit radikalen Ankündigungen, deren baldige Aussetzung, Verhandlungen über Deals, begleitet von neuen Drohungen usw.. Diese Politik wird oft als erratisch und chaotisch bezeichnet, eine Kennzeichnung, die durchaus ihre Berechtigung hat. In den hiesigen Medien liest man häufig Wortmeldungen von Ökonomen, die erklären, wie schädlich die Zölle für die Weltwirtschaft wären, auch den Amerikanern selbst würden sie keineswegs nützen. Dieser Kritik kann man, zumindest in vielen Fällen, eine Berechtigung nicht absprechen.
Trumps Politik ist sicher nicht frei von Widersprüchen und er handelt nicht kohärent im Sinne einer ökonomischen Schule. Trotzdem folgt das Agieren Trumps einer Logik und basiert auf einer Interpretation der US-amerikanischen Interessen. Das soll im folgenden aufgezeigt werden.
In eigener Sache
Die Bundesregierung offenbart nach Monaten luftiger Absichtserklärungen und Durchhalteparolen ihre Vorstellungen von einem Haushalt 2026. Der Bundesrechnungshof rechnet nach und kommt zu dem Ergebnis, dass der Bund nächstes Jahr über 170 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen wird, etwa hälftig für den Kernhaushalt und die „Sondervermögen“. Damit wird künftig der Schuldendienst, ähnlich wie in den USA, zum größten Haushaltsposten werden. Seit Wochen ist nur mehr von Tricksereien die Rede, um einen zustimmungsfähigen Haushalt auszuweisen.
Für die SPD hat sich die Nibelungentreue zur CDU nicht ausgezahlt, die Kommunalwahlen in NRW bescheinigen ihr vor allem in den Großstädten des Ruhrgebiets ihren Bedeutungsverlust. Es gewinnt die AfD, sie verdreifacht ihr Ergebnis und legt nach und nach das Image der Ostpartei ab. Jetzt aber müsse man die Probleme schonungslos angehen, so schallt es aus den Parteizentralen. Als hätte man das nicht schon in allen Tonlagen gehört. Die nächsten Niederlagen der früheren Massen- und Volksparteien können kommen.
Selten treffen Entscheidungen in der kapitalistischen Welt auf unsere ungeteilte Zustimmung, eine Ausnahme bildet ein kürzlich veröffentlichtes Dekret des US-Präsidenten. Das Verteidigungsministerium heißt jetzt Kriegsministerium. Das Kindchen darf sich jetzt offen zu seiner Mutter bekennen. Wir hoffen, dass die politische Ehrlichkeit bei den europäischen Nato-Partnern Einzug hält. Auch dem deutschen Fachminister Pistorius würde die neue Titulierung schließlich gut zu Gesicht stehen.
Die Betrachtung der Zollpolitik des US-Präsidenten setzt die Analyse des Rechtspopulismus in den USA fort. Dabei wird schnell klar, dass der Ansatz des US-Präsidenten weit über die „klassischen“ Vorstellungen vom wirtschaftlichen Nutzen dieser Abgabe hinausgeht. Diese neuartigen Erfahrungen machen zurzeit auch die Handelspartner.
Den Kommentar zum Armuts- und Reichtumsbericht von Oxfam für dieses Jahr konnten wir leider nicht in den letzten Nummern der Arbeiterstimme unterbringen. Dabei thematisiert der Artikel, über die bloßen Vermögenszahlen hinaus, ein zunehmend wichtig gewordenes, aktuelles Problem der Gegenwart: die massiv gestiegene Macht und der weiter wachsende Einfluss von Milliardären und ihre unmittelbaren Eingriffe in die Gesellschaften, die von ihren Entscheidungen abhängen. Ob sich die Buddies Elon und Donald aktuell gerade grün sind oder nicht.
Die Rückseite der Milliardenvermögen, die (Eigen-)Finanzierung der Renten, greift ein Artikel auf, der uns von einem langjährig verbundenen Leser zugesandt wurde. Dabei gehen die Erfordernisse der Gewinnmaximierung vor. Die Sicherstellung einer Rente, die das Leben ohne Lohnarbeit in Würde ermöglicht, wird dieser Prämisse durch die zahlreichen „Reformen“ mit den bekannten Folgen untergeordnet.
In Großbritannien machen die großen, rechtsradikal organisierten Demonstrationen gegen die MigrantInnen Schlagzeilen, der berüchtigte Nigel Farage feiert mit der Rechtspartei Reform UK neue Erfolge. Dabei war doch die Regierung Starmer mit einigen Vorschusslorbeeren gestartet, um die Johnson-Jahre hinter sich zu lassen. Unser englischer Genosse fasst diese weitere Übergangszeit in einem Beitrag zusammen.
Die Rezensionen nehmen diesmal einen ihnen gebührenden Raum ein.
Ein Thema hat mit der Hinwendung der Bundeswehr nach Osten für kaum mehr erwartbare Aufmerksamkeit in linken Milieus gesorgt: die Wehrmachtsverbrechen in Belarus. Eine schon seit Jahrzehnten vorliegende Zeitzeugenbefragung aus Belarus wurde unter dem Titel „Feuerdörfer“ in der Bundesrepublik erstmals verlegt, ein Genosse hat die Ausgabe für diese Nummer gewürdigt.
Etwas kurios mutet eine Geschichte an, die die Gruppe seit vielen Jahren begleitet hat. Unser Genosse Hans Steiger hatte einen Namenszwilling in der Schweiz, der den Kontakt aufgenommen hat. Auch er steht politisch links und ist für unsere Ausrichtung aufgeschlossen. Vor allem fanden sich beide Steiger einander so verbunden, dass der Kontakt niemals abriss. Der Schweizer Hans Steiger stellt seinem Namensvetter zu Ehren der Arbeiterstimme eine Rezension zur Verfügung, die Jean Zieglers neues Buch „Trotz alledem! Warum ich die Hoffnung auf eine bessere Welt nicht aufgebe.“ vorstellt. Jean Ziegler wiederum hat die Arbeit unserer Gruppe gekannt, unsere Veröffentlichungen geschätzt und uns Mut zugesprochen. Deshalb ist es uns ein doppeltes Anliegen, mit diesem Text beide Genossen zu Wort kommen zu lassen.
Mit einer längeren Darstellung greift unser Autor die Analyse von Heiner Karuscheit zum Weg des Deutschen Kaiserreichs in den Ersten Weltkrieg auf. Insbesondere die Frage, wie diese Gesellschaftsordnung zu charakterisieren ist. Bürgerlich oder nicht, welche Klasse herrschte in Wilhelms Reich? Dass in dieser Betrachtung bisherige Erklärungsmuster des linken Politikverständnisses von Lenin bis zur SED/DKP verworfen werden, blieb in der Redaktion nicht unwidersprochen. Wir veröffentlichen den Text, weil wir erstens neue Ansätze nicht ausblenden wollen und zweitens unsere Leserschaft für kompetent genug halten, sich eine eigene Meinung zu bilden. Ein Leserbrief Karuscheits zur Strategie linksradikaler Politik während der Novemberrevolution in Deutschland schließt den Themenkreis ab.
Ein technisches Versehen hat in der letzten Printausgabe den Beitrag „Israel im Krieg“ getroffen und ihm seinen Schlussteil genommen. Wir möchten uns bei unserem Autor Georg Auernheimer und den LeserInnen dafür entschuldigen.
Allerdings war unsere Online-Ausgabe nicht betroffen, der Gesamttext stand immer zur Verfügung und kann nach wie vor abgerufen werden
Gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, dass Georg Auernheimers neues Buch „Zweierlei Antisemitismus. Staatsräson vor universellen Menschenrechten?“ im August 2025 erschienen ist und unter anderem die Rolle des Antisemitismus in der Politik der Bundesrepublik untersucht. Wir halten diesen Aspekt im Anschluss an die Diskussion mit dem Autor im Mai dieses Jahres für außerordentlich wichtig. Israelkritische Linke jeglicher politischer Ausrichtungen sind von den deutschen Repressionsmaßnahmen, Verleumdungen und Verurteilungen betroffen. Auernheimers Darlegung werden wir in der nächsten Nummer der Arbeiterstimme vorstellen und bewerten.
Beachtet bitte bei euren Überweisungen die Neue Bankverbindung:
M. Derventli, GLS-Bank
IBAN: DE70 4306 0967 1353 5653 00
BIC: GENODEM1GLS
Wir weisen nochmal auf unsere diesjährige Jahreskonferenz am 4. und 5. Oktober in Nürnberg hin. Anmeldungen erfolgen über die Redaktionsadresse.
Die Linke Literaturmesse in Nürnberg findet heuer vom 31. Oktober bis 2. November statt.
Oxfams Ungleichheitsbericht und die Macht der Milliardäre
Zum Weltwirtschaftsforum in Davos veröffentlicht Oxfam bereits seit Jahren den großen Ungleichheitsbericht, den Bericht über die Verteilung von Reichtum in der Welt. Der aktuelle Bericht „Milliardärsmacht beschränken, Demokratie schützen“ zeigt, wie der Einfluss von Superreichen die soziale Ungleichheit immer weiter verschärft und demokratische Prinzipien in ihren Grundfesten erschüttert. Doch zuerst ein Blick auf die Schattenseite des Reichtums.
(Die Zitate stammen, fall nicht anders gekennzeichnet, aus dem Bericht von Oxfam)
„Reicher Mann und armer Mann
standen da und sah’n sich an.
Und der Arme sagte bleich:
Wär’ ich nicht arm, wärst Du nicht reich.“
(Bertolt Brecht)
Die Kehrseite des Reichtums: Wärn wir nicht arm …
Die Zahl der Menschen, die unter der erweiterten Armutsgrenze der Weltbank von 6,85 US-Dollar leben, ist seit 1990 unverändert bei fast 3,6 Milliarden geblieben. Das entspricht aktuell 44 Prozent der Menschheit. Frauen sind besonders von Armut betroffen. Weltweit müssen 733 Millionen Menschen infolge von Armut hungern – etwa 152 Millionen mehr als 2019.
Viele Länder stehen vor dem Bankrott, sind durch Schulden gelähmt und haben nicht die finanziellen Mittel, um Armut und Ungleichheit zu reduzieren. Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen geben im Durchschnitt 48 Prozent ihres Haushalts für die Rückzahlung von Schulden aus. Das ist weit mehr, als sie für Bildung und Gesundheit zusammen aufwenden. Die Situation ist für diese Länder besonders schwierig, aber auch darüber hinaus zeichnet sich ein besorgniserregendes Bild ab, wie Oxfam in seinem jüngst veröffentlichten Commitment to Reducing Inequality Index, einer Ungleichheitsanalyse von 164 Ländern, zeigt: Vier von fünf Ländern weltweit haben in den letzten von Krisen geprägten Jahren den Anteil im Staatshaushalt für Bildung, Gesundheit und soziale Sicherung gekürzt; vier von fünf haben Rückschritte bei der Steuerprogression und neun von zehn bei Arbeitsrechten und Mindestlöhnen gemacht. Insgesamt sind neun von zehn Ländern in einem oder mehreren dieser drei Bereiche zurückgefallen. Ohne sofortige politische Maßnahmen zur Umkehrung dieses Trends wird daher die Ungleichheit in 90 Prozent der untersuchten Länder mit großer Sicherheit weiter zunehmen. Der ohnehin schon immense Druck auf die politische Stabilität würde damit noch größer – und damit auch die Gefahr für die Demokratie.
Weiterlesen: Oxfams Ungleichheitsbericht und die Macht der Milliardäre
Klassenfragen enden nicht nach 67 Lebensjahren
Die Sozialministerin Bärbel Bas orakelt von der Einbeziehung der Beamten in die Gesetzliche Rentenversicherung. Die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche bringt einen weiteren Anstieg des Rentenalters (über 67 Jahre hinaus) ins Spiel. Laut Koalitionsvertrag soll eine Kommission bis Mitte der Legislaturperiode (das wäre etwa Anfang 2027) Vorschläge für eine „Rentenreform“ erarbeiten. Konkrete Entscheidungen sind zwar noch nicht gefallen, aber in der Zukunft ist mit Veränderungen, real wohl Verschlechterungen, bei den Renten zu rechnen. Zu diesem Thema hat uns folgende Zuschrift eines Lesers und gelegentlichen Autors erreicht.
RENTENPOLITIK: Klassenfragen enden nicht nach 67 Lebensjahren
Seit Bildung der Regierungskoalition von CDU/CSU und SPD werden Stimmen wieder lauter, Beitrage für die sozialen Sicherungssysteme „zukunftssicher“ festzuschreiben oder aber bislang gewährte Leistungsstandards abzusenken. Denn als zentral kassierte zwangssolidarische Lohnbestandteile bilden die Beitrage ein Drittel der jeweiligen Lohnhöhe und schmälern bei weiterem Zuwachs die Gewinnsituation der Betriebe. Das meint die Rede vom drohenden Verlust der „Wettbewerbsfähigkeit“. Dass diese beständige Klage über die „Abgabenlast" verunsicherte Haltungen bei der Masse der Lohn- und Gehaltsbezieher bewirkt, belegt eine erneute Umfrage von Infratest Dimap: „Aktuell sehen 49 Prozent Bedarf für eine grundlegende Reform der gesetzlichen Rentenversicherung, während 36 Prozent 'gezielte Anpassungen' wünschen. Nur elf Prozent finden: Alles 'sollte so bleiben', wie es ist." Insgesamt haben 81% der Befragten kein Vertrauen in die Bundesregierung, notwendige Maßnahmen einzuleiten, damit die Rentenversicherung „zukunftssicher“ ist. (1)
Starmers Labour, ein Neues Projekt
Nach 14 Jahren Tory-Herrschaft und vier Premierministern, die einen Sparkurs durchsetzten, kam Labour im Juli 2024 mit sehr großer Mehrheit an die Regierung zurück. Die Tories befanden sich mehrere Jahre in einer Krise. Gegen Ende waren sie in vielleicht ein Dutzend verschiedene Fraktionen oder Cliquen zersplittert um jeweils eine Person, die sich verzweifelt bemühte, Parteiführer zu werden. Jede von ihnen versuchte, noch weiter rechts als die anderen zu erscheinen, um auf die Parteimitglieder Eindruck zu machen.
Der NHS (Nationaler Gesundheitsdienst) befand sich in der Krise. Die Menschen mussten warten, bis sie für eine geplante Operation oder einen Notfall ins Krankenhaus konnten. Das Eisenbahnnetz litt unter Verspätungen und dem Ausfall ganzer Züge. Eine Anzahl der privatisierten Gesellschaften wurden renationalisiert, um den Service zu verbessern. Es haperte am Bau neuer Wohnungen, wobei die Baukosten sehr hoch waren. Ein Drittel der Kinder leben in Armut. Die Tories hatten die finanzielle Unterstützung, die jede Familie für jedes Kind erhielt, auf zwei Kinder pro Familie beschränkt. Für alle weiteren Kinder gab es keine Unterstützung mehr.
Verzweifeltes Vermächtnis
„Où est l'espoir?“ Mit seinem Fragezeichen war der Titel der im vergangenen Herbst erschienenen Originalausgabe treffender. Zieglers deutscher Verlag kündigte das jüngste, vielleicht letzte Buches des nun 91-Jährigen als „kämpferisches Vermächtnis“ an. Doch es klingt verzweifelt.
Emanzipation, Gleichheit,
Gerechtigkeit hängen von uns ab.
Ja, „diese Verantwortung haben wir“.
Zuerst entfernte ich den widerwärtigen Kleber: Für mich ist Jean Ziegler kein ‚SPIEGEL-Bestseller-Autor’, sondern ein radikal engagierter Genosse, der schreibend abzuwenden versucht, was er kommen sieht. Auf dem Buchumschlag wird er gross, rot, undifferenziert als „unermüdlicher Globalisierungskritiker“ präsentiert. Was eigentlich falsch ist. Er fordert weltweite Solidarität. Allerdings will er einen grundlegenden Wandel; „der Kapitalismus ist nicht reformierbar“, als System nicht zu zivilisieren. Als sich auch offen zum Katholizismus bekennender Sozialist glaubt er, wohl durchaus religiös, ein Sturz unserer „kannibalischen Weltordnung“ sei möglich, stehe bevor. Ob sein „Trotz alledem!“ mit dazu beiträgt? Vielleicht. Naiv ist er ja nicht.
Radikal anklagendes Inventar
Er liefere im Buch „das Inventar der wichtigsten Katastrophen“ sowie „der Strategien, die es zu erschaffen gilt“, um diese zu überwinden, steht im ersten Absatz. Letzteres bleibt skizzenhaft, die Beschreibung der Lage jedoch ist sprachlich wie faktisch erschütternd. Nach neuesten Daten der Vereinten Nationen „vernichten“ von Not und Elend ausgelöste Konflikte pro Jahr fast so viele Menschenleben wie der Zweite Weltkrieg insgesamt und eine neue kriegerische Phase hat begonnen. Ziegler spricht nicht nur das Drama in der Ukraine an, wo er sich „vollkommen ohnmächtig“ fühle, zum Zuschauer des neuen Angriffs des „Massenmörders Putin“ degradiert, der zuvor schon Tschetschenien zerstörte. Breiter und mit Blick auf die historischen Wurzeln und die tragisch verpassten Chancen wird das Geschehen in Gaza beleuchtet. Syrien, Afghanistan, der Sudan ... Und immer profitiert die Waffenindustrie von Vernichtung und Sterben, die Rüstungsspirale rotiert noch rascher. Auch in der Schweiz verdienen viele mit. Während dem Staat Israel mit gutem Gewissen die tödlichsten der vorhandenen Waffen geliefert werden, wird gebeten, die zivilen Opferzahlen „möglichst niedrig“ zu halten.
"Feuerdörfer“
Eigentlich ist das hier besprochene und empfohlene Buch “Feuerdörfer – Wehrmachtsverbrechen in Belarus – Zeitzeugen berichten“ der Autor*innen Ales Adamowitsch, Janka Bryl und Uladasimir Kalesnik ein altes. Schon 1975 war es in Belarus erschienen, aber da konnten es die meisten aufgrund fehlender Sprachkenntnisse nicht lesen. Danach wurde es in der DDR verlegt, aber aus politischen Gründen (und weil wohl noch viele Täter lebten?) durften wir es nicht lesen. Jetzt ist es im Aufbau-Verlag, Berlin herausgekommen, hat jüngst für die Übersetzung den deutschen Buchpreis bekommen. Jetzt können und dürfen wir die 357 Seiten lesen. Und wir sollten sie lesen!
Nicht nur, weil sich der Untergang der nationalsozialistischen, rassistischen, mörderischen Diktatur zum 80sten Mal jährt und die Nazis „nicht vom Himmel gefallen“ sind. Viele haben bei ihren Verbrechen mitgeholfen und sind oft später nicht zur Verantwortung gezogen worden. Von diesen brutalen Verbrechen, fußend auf einer rassistischen Vernichtungsideologie, berichten für den Raum Belarus Zeitzeugen in diesem Buch. Das massenhafte Morden und Verbrennen der einheimischen Bevölkerung, die systematische Entvölkerung des „Lebensraums im Osten“ wurde mit dem „Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion“ begonnen. Bereits Anfang 1941 forderte Heinrich Himmler, die slawische Bevölkerung um 30 Millionen zu vermindern. Für den Vernichtungskrieg wurden Recht und Gesetz außer Kraft gesetzt. „Für Handlungen, die Angehörige der Wehrmacht und des Gefolges gegen feindliche Zivilpersonen begehen, besteht kein Verfolgungszwang, auch dann nicht, wenn die Tat zugleich ein militärisches Verbrechen oder Vergehen ist.“, heißt es in Adolf Hitlers Kriegsgerichtsbarkeitserlass vom 13.05.1941.
Für das Buch reisten Autorin und Autoren durch versengte Landschaften in der belarussischen Provinz, zeichneten in 147 Dörfern Gespräche mit Überlebenden der verbrannten Dörfer auf, führten und transkribierten über 300 Gespräche.
Zwischen 1941 und 1944 fielen in Belarus über zwei Millionen Menschen den deutschen Mordkommandos zum Opfer, mehr als 9.100 Dörfer wurden zerstört.
„In jedem Hof hatten sie drei Mann abgestellt, die alle gleichzeitig die Menschen umbringen sollten. (…) Und dann kommen sie ins Haus und bringen die Kinder um, die alten Weiblein...Mir haben sie die Mutter getötet. (...) Die Patronen lagen da und alles… Alles lag da. Ich kam später und konnte nur noch meine Leichen begraben. (…) Nur die nicht verbrannt waren. (…) 180 Menschen haben sie umgebracht.“ (Auszüge aus dem Interview mit Iwan Wikenzjewitsch aus Hardoka). Dieses Interview verdeutlicht Dreierlei: Erstens: Das Buch ist nichts für schwache Nerven, vor allem nicht die Interviews! Zweitens:Die Augenzeugen reden einfach, sind „einfache“ Menschen, sind keine Intellektuellen. Drittens: Faschisten und Rassisten reden nicht einfach so nur daher, sondern setzen das Gesagte auch um! Das sollte auch nicht vergessen werden!
Das im Buch aufgelistete Grauen wurde nicht nur billigend in Kauf genommen, sondern viele deutsche Täter und ihre Helfer übten bewusst und überzeugt die schlimmsten Grausamkeiten und Morde aus. Auch dies sollte heute noch zu denken geben!
Das Buch möge, wie im Nachwort geschrieben, als Pionierwerk des dokumentarischen, vielstimmigen Erzählens seinen festen Platz in der deutschen und internationalen Erinnerungskultur bekommen.
Frank Rehberg
Feuerdörfer. Wehrmachtsverbrechen in Belarus – Zeitzeugen berichten
von Ales Adamowitsch, Janka Bryl und Uladsimir Kalesnik
Aufbau Verlag 2024
Karuscheits Trilogie zur neueren deutschen Geschichte
Vorbemerkung der Redaktion:
Jemand, der im Westen Deutschlands Sozialist werden wollte, konnte die dafür notwendige Bildung nicht in seiner Schule erhalten. Er musste sich andere Lehrer suchen. Hier standen viele Alternativen zur Verfügung. Beim Autor dieser Zeilen reichte das von Bernt Engelmann1, einem linken SPDler, über die Zeitschrift KONKRET und die frühe taz, bis zum Trotzkismus und der DKP.
Weiterlesen: Karuscheits Trilogie zur neueren deutschen Geschichte
Leserbrief
Leserbrief zur linksradikalen Politik der KPD
In der Ausgabe der Arsti Nr.226 vom Winter 2024 „Das Verhängnis einer ultralinken Politik unter vorrevolutionären Bedingungen am Beispiel der KPD 1919-1933“ hat Harald Jentsch sich kenntnisreich mit der linksradikalen Politik der KPD auseinandergesetzt. Der Kritik kann man im Wesentlichen nur zustimmen, doch meine ich, dass sie noch einen Schritt weiter gehen müsste. Warum?
Die zentrale Frage zur Bewertung der KPD-Politik lautet nach meinem Dafürhalten, ob die Revolution, die nach dem Weltkrieg auf die Tagesordnung trat, dem Wesen nach eine proletarisch-sozialistische oder eine bürgerlich-demokratische Revolution war. Für die Spartakusgruppe und die aus ihr hervorgehende KPD war dies keine Frage, sie kämpfte als nächstes Ziel für eine sozialistische Revolution. Das von Rosa Luxemburg verfasste „Oktoberprogramm“ der Spartakus-Gruppe propagierte als Aufgabe des Tages die Errichtung der Diktatur des Proletariats, ebenso das mit dem „Oktoberprogramm“ weitgehend identische Gründungsprogramm der KPD vom 30. Dezember 1918.
Darin wurde mit Blick auf den Übergang zum Sozialismus u.a. die „Enteignung des Grund und Bodens aller landwirtschaftlichen Groß- und Mittelbetriebe“ zwecks „Bildung sozialistischer landwirtschaftlicher Genossenschaften“ gefordert; nur „bäuerliche Kleinbetriebe“ sollten davon ausgenommen werden. Das heißt, Spartakus/KPD forderten nicht nur die Enteignung des Großgrundbesitzes, sondern der Masse der Bauernschaft. Eine solche Forderung musste das gesamte Kleinbürgertum, d.h. mehr als der Hälfte der Bevölkerung, zum Gegner der revolutionären Arbeiterbewegung machen. Dieses Revolutionsprogramm fand auch im Proletariat selber keine Mehrheit; die Spartakusgruppe war in der Rätebewegung isoliert.
Um die Novemberrevolution zum Erfolg zu führen, wäre das Konzept einer vom Proletariat geführten demokratischen Revolution im Bündnis mit dem Kleinbürgertum notwendig gewesen; erst deren Erfolg konnte den Weg zum Sozialismus frei machen. Es gab in der Vorkriegs-SPD auch immer wieder Diskussionen über das Verhältnis von demokratischem und sozialistischem Kampf sowie die Frage des Kleinbürgertums. Doch keine dieser Debatten wurde zu Ende geführt. Mit dem Revolutionsprogramm Luxemburgs war der revolutionäre Flügel der Arbeiterbewegung jedenfalls zum Scheitern verurteilt.
Daran schließt sich eine weitere Frage an, die in einem Leserbrief nur angerissen werden kann. Gemeinhin gilt die Novemberrevolution als gescheiterte sozialistische Revolution. Aber muss sie nicht richtigerweise als gescheiterte bürgerliche Revolution gewertet werden?
Denn was war ihr Ergebnis anderes als eine nicht lebensfähige Republik, die aus einer von der SPD-Führung im Bündnis mit der preußischen Obersten Heeresleitung organisierten Konterrevolution gegen die Novemberrevolution hervorging (Ebert-Groener-Pakt)?
Es gab keine soziale Umwälzung, denn weder wurde der Großgrundbesitz enteignet noch Großindustrie und die Banken (deren Verstaatlichung einen späteren Übergang zum Sozialismus ermöglicht hätte). Erst recht nicht wurde der preußisch-deutsche Obrigkeitsstaat zerschlagen und neue demokratische Strukturen aufgebaut (was die Rätebewegung in Angriff genommen hatte). Insbesondere behielt der junkerliche Militäradel die Herrschaft über die Streitkräfte, das entscheidende innenpolitische Machtinstrument. Real war die Republik nicht mehr als ein Überwurf ohne eigene Basis über den fortbestehenden gesellschaftlichen und staatlichen Strukturen der alten Ordnung.
Wenn man die Novemberrevolution aber als gescheiterte bürgerliche Revolution begreift – liegt hier nicht ein Schlüssel für den Aufstieg des Nationalsozialismus, der sich als Gegenbewegung nicht nur gegen „1917“ verstand, sondern auch gegen „1789“, d.h. gegen die zivilisatorischen Errungenschaften der bürgerlichen Revolution?
Gegenwärtig wird erneut der „Kampf gegen rechts“ gefordert, bis hin zur Warnung vor einem neuen Faschismus. Um derartige Forderungen richtig einzuordnen, würde es sich m.E. lohnen, wenn die Kommunisten die Fragen, die am Anfang ihrer Bewegung nach dem Ersten Weltkrieg aufgeworfen wurden, noch einmal reflektieren würden, auch wenn das heißt, scheinbar sichere alte Gewissheiten auf den Prüfstand zu stellen.
Heiner Karuscheit, Gelsenkirchen, 5.Mai 2025