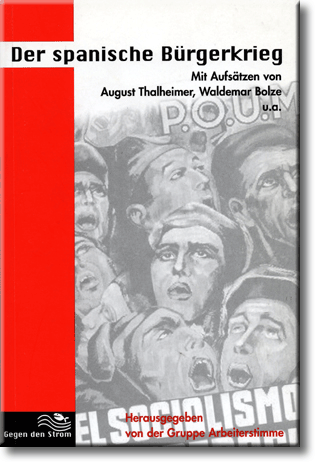Der marxistische Historiker und Orientalist Maxime Rodinson hat 1973 – sechs Jahre nach der Junikrieg von 1967 – geschrieben: „Im 20. Jahrhundert im arabischen Palästina einen rein oder überwiegend jüdischen Staat errichten zu wollen, konnte nur zu einer Art Kolonialsituation führen, in der sich (soziologisch gesprochen, völlig normal) eine rassistische Geisteshaltung entwickeln musste und in der letztendlich eine militärische Konfrontation zwischen den beiden ethnischen Gruppen unausweichlich war.“ Und man kann hinzufügen: eine zunehmende Radikalisierung auf beiden Seiten. Die Kette von Gewaltakten, von Aufständen, Terror und Kriegen war von Anfang an in diesem historischen Projekt Israel angelegt.
Ich werde zuerst Gründe für die Radikalisierung der Konfliktparteien benennen. Dann werde ich versuchen, die Konfliktdynamik zu erklären und dabei mehrere Stufen der Gewalteskalation bis zur heutigen Ausweglosigkeit unterscheiden.
Innerhalb der frühen zionistischen Bewegung, die politisch sehr heterogen war, wurden zwei sehr unterschiedliche Zukunftsperspektiven für Palästina erwogen. Eine Minderheit träumte von einem friedlichen Zusammenleben von Juden und Arabern. Dagegen stand das Streben nach einem exklusiv jüdischen Staat. Der Teilungsplan der UNO von 1947 erledigte eine Debatte darüber. Hanna Arendt fürchtete 1948 nach der Vertreibung der Palästinenser, das Projekt könne zu einem „Albtraum“ werden.
In dem „hundertjährigen Krieg“ (Rashid Khalidi), der schon um 1920 begonnen hat, haben sich beide Seiten zunehmend radikalisiert (Achcar 2012, 232). Auf Seiten der Palästinenser haben in den letzten Jahrzehnten die Islamisten die Oberhand gewonnen, in Israel Fanatiker wie die Kahanisten,i auf beiden Seiten Fundamentalisten. Die verständliche Verbitterung darüber, dass ihnen ständig ihre Rechte vorenthalten wurden, hat die Palästinenser in die Arme von Hamas und Islamischem Dschihad getrieben. Die totale Militarisierung der israelischen Gesellschaft hat eine allgemeine Militanz erzeugt. Die Palästinenser sind für die Israelis unbekannte Wesen, meint die israelische Soziologin Eva Illouz. Man traut ihnen nicht.ii Viele hassen sie. Kahanisten können jährlich ungestört mit dem Ruf „Tod den Arabern“ durch Ostjerusalem marschieren. Es gibt nur noch wenige Israelis, die nicht den totalen Krieg befürworten.iii
In einem Aufruf vom 22. September 1967 warnte die Sozialistische Organisation Matzpen: „Besatzung bedeutet Fremdherrschaft. Fremdherrschaft bedeutet Widerstand. Widerstand bedeutet Unterdrückung. Unterdrückung bedeutet Terror und Gegenterror… Wenn wir an den besetzten Gebieten festhalten, werden wir zu einer Nation von Mördern und Mordopfern.“iv
Eine Empathiefähigkeit, wie sie eine Äußerung von Moshe Dayan aus dem Jahr 1956 zeigt, ist heute unvorstellbar. Es war bei der Beerdigung eines Kibbuz-Mitglieds, das ermordet worden war.
„Warum sollten wir ihnen ihren brennenden Hass auf uns zum Vorwurf machen? Seit acht Jahren hausen sie in den Flüchtlingslagern von Gaza, und wir haben unter ihren Augen das Land und die Dörfer, in denen sie und ihre Vorväter gewohnt haben, in unser Eigentum verwandelt.“v
Eine Ursache der Radikalisierung sehe ich zunächst einmal darin, dass die Israelis als Opfer des Holocaust und auch als Opfer des damaligen Versagens der Weltgesellschaft Ausnahmen vom internationalen Recht für sich in Anspruch genommen haben. Sie haben sich offenbar zur Vertreibung der Palästinenser legitimiert gesehen. Nach der Nakba konnten die Palästinenser ihrerseits die Ausnahme für sich in Anspruch nehmen und ihren Widerstand ohne Unrechtsbewusstsein auf Terror stützen. Der Ausnahmestatus wurde vom Ausland allerdings nur den Israelis zugestanden.
Die vorbehaltlose Unterstützung Israels seitens des Westens, ab 1967 vor allem seitens der USA, hat den israelischen Regierungen eine Art Freibrief verschafft. Sie ist teils dem Schuldbewusstsein, teils geopolitischen Interessen geschuldet.
Eine zweite Ursache der Radikalisierung ist darin zu suchen, dass der Kampf der israelischen Streitkräfte gegen den palästinensischen Widerstand ein asymmetrischer Krieg ist. Die militärisch schwächere Partei ist genötigt, den Feind mit Überfällen oder Anschlägen zu verunsichern. Terror, oft verbunden mit Gewaltexzessen, ist typisch für asymmetrische Kriege. Das war die Strategie der Indigenen in allen kolonialen Befreiungskriegen. Der Historiker Enzo Traverso zählt dafür viele Beispiele auf (1994, 90f.). Ein Vertreter der algerischen Befreiungsfront soll auf die Kritik an Bombenanschlägen in Restaurants geantwortet haben: Hätten wir die Flugzeuge und Panzer der Franzosen, würden wir die nutzen. Wir haben nur selbst gebastelte Bomben. Durch solche Methoden des Partisanenkampfs sehen sich konventionelle Streitkräfte überfordert. Denn man weiß nie, wo der Feind lauert, wer ihn unterstützt. Die typische Reaktion ist ein schonungsloses Vorgehen ohne Rücksicht auf die Einschränkungen des Kriegsrechts, d.h. ohne Schonung der Zivilbevölkerung. Alle können Feind sein. Und tatsächlich haben Freischärler meist die Bevölkerung voll hinter sich. Jitzchak Herzog, der israelische Präsident, erklärte: „Es gibt keine unschuldigen Zivilisten in Gaza.“ Der Sicherheitsminister Ben-Gvir zog die radikale Konsequenz: „Allesamt sind Terroristen. Und sie müssen beseitigt werden“.vi
Die Juristin Malikit Salha zu dieser Schuldverlagerung: „Als Aggressoren im asymmetrischen Krieg gelten politisch grundsätzlich die ‚Terroristen‘, nicht die Staaten.“vii Die militärische und politische Schlussfolgerung, nicht erst seit dem Oktober 2023: Kollektivstrafen wie Abriss von Wohnhäusern, Präventivschläge, meist Bombardements, der Tod von Zivilisten ist einberechnet. Die gelten als „freiwillige menschliche Schutzschilde“. Es werden keine Gefangenen gemacht. Verschiedene militärische Doktrinen der israelischen Streitkräfte decken solches Vorgehen seit Jahrzehnten (die Dayan-Doktrin, die Betlehem-, die Dahiya-Doktrin). Man schont im Extremfall auch die eigenen Leute nicht (Hannibal-Direktive).viii Alles unverträglich mit dem internationalen Recht.
An dieser Stelle aber ein Wort zum Widerstandsrecht: Die Hamas und andere Milizen als Terrororganisationen einzustufen, ist, genau genommen, nicht berechtigt, auch wenn Terrorakte zu ihrer Strategie gehören, abgesehen davon, dass es einen zivilen und einen militärischen Arm gibt. Hamas und Islamischer Dschihad können sich auf das Widerstandsrecht berufen. Es wurde den Palästinensern mit der UNO-Resolution 242 vom 22. November 1967 indirekt zugestanden, weil dort der Rückzug der israelischen Streitkräfte gefordert und auf der „territorialen Unversehrtheit und politischen Unabhängigkeit eines jeden Staates in der Region“ bestanden wird. Und mit den UNO-Resolutionen 37/42 von 1982 und 45/130 von 1990 hat die UNO-Generalversammlung explizit das Recht unterdrückter Völker erklärt und bekräftigt, „sich mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, einschließlich des bewaffneten Kampfes, zu befreien“.
Europäer konnten nicht problemlos einen schon bevölkerten Landstrich besiedeln, jedenfalls nicht mehr im 20. Jahrhundert. Widerstand war zu erwarten. Das war den Initiatoren auch klar.
Aber wer hätte es nach 1945 fertiggebracht, einer jüdischen Familie zu sagen: „Nach Palästina zu gehen, das könnte ihr nicht machen. Ihr wisst schon, dass ihr da Leute verdrängt? Und die Einheimischen haben sich auch schon dagegen gewehrt.“ – Ja, man kann die Geschichte Israels als Tragödie interpretieren. Da hat sich ein Volk, das über Jahrhunderte verfolgt war, schrittweise einen Staat erkämpft. Es wird unausweichlich in blutige Konflikte verwickelt und lässt sich zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit verleiten. Am Anfang der Tragödie standen der Antisemitismus in Europa, gipfelnd im Holocaust, und zwei europäische Erblasten, der Nationalismus und die koloniale Idee.
Den Zionisten war klar, dass Palästina kein unbesiedeltes oder ungenutztes Land war, wie sie später der Weltöffentlichkeit suggerieren wollten. In einer Tagebuchnotiz von1895 schrieb Theodor Herzl: „Die einheimische arme (arabische, Anm. d. Verf.) Bevölkerung trachten wir unbemerkt über die Grenze zu schaffen, indem wir ihr in den Durchgangsländern Arbeit verschaffen, aber in unserem Land jederlei Arbeit verweigern.“ Aber mit ökonomischer Gewalt allein sollte es später nicht gehen. Wer war Theodor Herzl?
Herzl (1860 – 1904) war ein ungarisch-österreichischer Schriftsteller und Publizist. Er erlebte im Habsburger Reich den Verfall der alten Ordnung, das Aufkommen der Konkurrenzgesellschaft und des Nationalismus und das davon begleitete Anschwellen des Antisemitismus in Europa. Die Zuerkennung gleicher bürgerlicher und politischer Rechte für die Juden hatte nach 1870 die antisemitischen Ressentiments verstärkt. Historiker verzeichnen mehrere „Antisemitismuswellen“.ix Der Antisemitismus bestimmte die gesellschaftlich wichtigsten Milieus, das Bildungsbürgertum, darunter die Studentenverbände, aber auch die ländliche Bevölkerung. Hetzschriften fanden weite Verbreitung. Einige Journalisten wie Julius Langbehn erlangten damit Popularität. Juden wurden zum Gegenstand der neuen Rassenlehre, speziell auch in Frankreich. In ganz Europa wurden Juden stigmatisiert. Im Zarenreich wurden sie wiederholt Opfer grausamer Pogrome.
Die Assimilation brachte nicht die gewünschte Anerkennung. Im Gegenteil, je mehr sich die Juden anpassten, desto mehr begegneten sie Neid und Misstrauen. Und sie galten als illoyal, als verdächtige Fremde, hatten keinen Ort in der neuen Welt der Nationalstaaten. Was lag da näher, als auch für Juden eine eigene Nation anzustreben? 1894 wurde in Frankreich ein Offizier jüdischer Herkunft des Landesverrats verdächtigt und verurteilt. Die bekannte Dreyfus-Affäre. Die hat Herzl möglicherweise besonders verschreckt oder verstört. Dass im Land der Aufklärung so etwas möglich war, nicht im rückständigen Zarenreich! 1896 verfasste Herzl das Buch „Der Judenstaat“. Und mit anderen jüdischen Intellektuellen organisierte er den ersten Zionistischen Weltkongress, der 1897 in Basel stattfand. Zentral in dem dort verabschiedeten Programm war das Streben nach einer „Heimstätte des jüdischen Volkes“.
Zur Idee des Nationalstaats kam die genuin europäische Vorstellung von der zivilisatorischen Mission. Schon Moses Hess (1812 – 1875) hatte eine Generation vor Herzl für die Juden die Rolle als „Zivilisationsträger“ vorgesehen.x Herzl versicherte, anscheinend schon mit Blick auf Palästina: „Für Europa würden wir dort ein Stück des Walles gegen Asien bilden, wir würden den Vorpostendienst der Kultur gegen die Barbarei besorgen.“xi Moses Hess wird übrigens zu den Frühsozialisten gerechnet. Damit wird deutlich, welch heterogene Elemente in den Zionismus einflossen. Einerseits die Gleichheitsidee, andererseits die zivilisatorische Mission, die das Bewusstsein der Überlegenheit gegenüber den Arabern impliziert. Die rechte Fraktion der Zionisten begnügte sich auch nicht mit der Idee von einer „nationalen Heimstätte“, sondern hatte schon früh die Vision von Eretz Israel, also einem Großisrael nach biblischem Muster. Das war verhängnisvoll.
Die Geschichte des Konflikts beginnt mit dem Ende des Osmanischen Reichs. Briten und Franzosen teilten den überwiegend arabischen Teil des Reichs unter sich auf. Großbritannien wurde Mandatsmacht über Palästina. Der britische Außenminister Arthur Balfour bestätigte die Zusage von 1917, eine „nationale Heimstätte“ für das jüdische Volk zu schaffen.xii Das zionistische Projekt begann also nicht erst 1948 in Reaktion auf den Holocaust.
Die Besiedlung durch europäische Juden (oder jüdische Europäer) führte bald zu Unruhen in Palästina, zunächst eher spontane Revolten. Ein Nationalbewusstsein war bei der arabischen Bevölkerung erst im Entstehen. Es beschränkte sich auf städtische Notabeln. Orientalische Juden bildeten übrigens damals rund elf Prozent der Bevölkerung. Schon früh wurde klar, dass die Araber sich nicht so leicht verdrängen lassen würden. 1920 gründeten sie ein Arabisches Exekutivkomitee. Der Zionist Wladimir Jabotinsky drängte 1923 auf „die Errichtung einer Macht in Palästina, welche in keiner Weise durch arabischen Druck beeinflusst wird.“ Tatsächlich gelang es den jüdischen Pionieren, obwohl noch gering an Zahl, erstaunlich schnell, wichtige Institutionen zu gründen: die Knesset als Vertretung gegenüber der Mandatsmacht, den Jüdischen Nationalfonds für den Landkauf, die Gewerkschaft Histatrut für die eigenen Betriebe und eine Miliz zur Verteidigung der jüdischen Siedlungen, die Hagana.
Nachdem es schon Ende der 1920er Jahre zu blutigen Auseinandersetzungen gekommen war, begann 1936 ein regelrechter Aufstand, eine Intifada, die mit Unterbrechungen bis 1939 dauerte. – die erste Eskalationsstufe. Von Protest, Streik, Boykott und Steuerverweigerung gingen die Araber zum bewaffneten Widerstand über. Sozioökonomische Konflikte um Land, um die Entlassung von Pächtern waren vorher schon religiös überlagert und verschärft worden. Das erwachende arabische Nationalbewusstsein verband sich teilweise mit der Ideologie der jungen Muslimbruderschaft, die kurz vorher in Ägypten gegründet worden war. Es wurde klar, dass da noch etwas den Konflikt befeuerte, nämlich die religiöse Bedeutung des Landes für die muslimischen und die christlichen Araber einerseits und für die Juden andererseits.
Zugleich suchten aufgrund der Rassengesetze im Deutschen Reich vermehrt Juden Zuflucht in Palästina. Die Beunruhigung der arabischen Vertreter nahm ebenso zu wie die Militanz der jüdischen Aktivisten. Die Briten waren ihres Auftrags müde und bereiteten das Ende der Mandatsverwaltung vor. 1937 legte eine britische Kommission einen Teilungsplan vor, der einen Bevölkerungsaustausch vorsah.xiii
1947 erhielt ein Komitee der gerade gegründeten UNO den Auftrag, eine Lösung des Konflikts vorzubereiten. Das Entsetzen über den Holocaust war allgegenwärtig. Ungeachtet der demographischen Verhältnisse empfahl das Komitee eine Zwei-Staaten-Lösung. Obwohl die Juden deutlich in der Minderheit waren, sollte ihr Territorium nach dem Plan größer sein als das palästinensische. Auf dem Territorium des jüdischen Staats hätten die Araber gut die Hälfte der Bevölkerung ausgemacht.xiv Trotzdem stimmte die UN-Generalversammlung (damals 58 Mitglieder) – Länder aus dem globalen Süden waren erst ein paar vertreten – am 29. November 1947 dem Teilungsplan mit 33 Ja-Stimmen zu, verankert in der Resolution 181.
Die Palästinenser lehnten die Teilung ab, antworteten mit einem Generalstreik, mit Straßensperren und Anschlägen. Die jüdischen Paramilitärs und Untergrundorganisationen, die mit britischer Hilfe in der Vergangenheit gebildet worden waren, unter anderem die Irgun, nutzten die Unruhen zur Übernahme arabischer Wohnviertel oder zur Zerstörung von Ortschaften. Ben Gurion hatte schon 1937 in einem Brief klar gestellt: „Die Araber werden gehen müssen“.xv Im Dezember 1947 begann die planmäßige ethnische Säuberung (Ilan Pappé). Zeitweise räumten die Verbände der Haganah und der Irgun mehrere Dörfer an einem Tag. Der Widerstand war schwach, weil die Palästinenser darauf nicht vorbereitet waren und ihre Führung von den Briten geschwächt worden war. Die Juden gingen mit großer Entschlossenheit, Planmäßigkeit und Erbarmungslosigkeit vor. Berüchtigt sind die Massaker von Deir Jasin und von Tantura.xvi Städte wie Haifa oder Jaffa wurden entarabisiert, Dörfer mit Bulldozern platt gemacht oder gesprengt, und zwar samt Moschee und Friedhof. 531 Dörfer wurden ausgelöscht. Das Zerstören und Morden dauerte vom Herbst 1947 bis mindestens zum Frühjahr 1949. 750.000 Palästinenser wurden vertrieben oder ergriffen bis 1949 die Flucht – für die Palästinenser die „Nakba“, die Katastrophe – m. E. die zweite Eskalationstufe.
Die UNO sicherte in ihrer Verlegenheit den Palästinensern mit der Resolution 194, Absatz 11 ein Rückkehrrecht zu, das ein leeres Versprechen bleiben sollte. Bei der totalen Zerstörung der Ort-schaften hätte man auch kaum von einer „Rückkehr“ sprechen können.
Am 14. Mai 1948 proklamierte Ben Gurion die Gründung des Staates Israel. Zögerlich entschlossen sich fünf arabische Regierungen, Truppen gegen Israel zu entsenden. Entgegen dem auch 1967 verbreiteten Gerücht drohte Israel nicht die Vernichtung. Denn die Haganah war den Truppen der gerade aus dem Kolonialverhältnis entlassenen Staaten strategisch überlegen. Ende Oktober 1948 hatten die Israelis neue, teilweise besonders fruchtbare und strategisch wichtige Gebiete erobert, insgesamt 77 Prozent des früheren Mandatsgebiets.
Dann kehrte für einige Jahre Ruhe ein bis zum Suezkrieg im Oktober 1956. Man ließ sich von Großbritannien und Frankreich zur Invasion auf die ägyptische Sinaihalbinsel verleiten, vermutlich in der Hoffnung auf Gebietsgewinne. Anlass für die sog. Suezkrise war die Verstaatlichung des Suezkanals bzw. der britischen Suezgesellschaft durch Ägypten gewesen. Der Krieg blieb wegen des Einspruchs der USA Episode, er zeigt nur, welche militärische Stärke Israel schon damals gewonnen hatte.
In den Folgejahren kam es immer wieder zu Grenzstreitigkeiten mit Jordanien und Syrien, unter anderem um das Wasser des Jordan. Das war auch ein indirekter Anlass für den sogenannten Sechstagekrieg. Dieser Krieg brachte die stärkste Eskalation des Konflikts nach 1948 mit sich.
Er begann im Juni 1967, als die ägyptische Regierung den Suezkanal sperrte und auf dem Sinai eine Armee aufmarschieren ließ. Ob Nasser einen Angriff auf Israel plante, ist unter Historikern umstritten. Verhandlungen hätten sich angeboten. Aber die israelische Führung entschied sich für einen Präventivschlag mit der Luftwaffe, die am 5. Juni die ganze ägyptische Luftflotte zerstörte. Damit waren die ägyptischen Truppen bei ihrem Gegenangriff ohne Luftunterstützung. Den Israel Defense Forces war der Sieg sicher, auch wegen der Aufrüstung durch die Bundesrepublik. Sie konnten in wenigen Tagen neues Territorium erobern, Sinai und Gaza von Ägypten, das Westjordanland von Jordanien und die Golanhöhen von Syrien.
Die Gebietsverluste versuchten Ägypten und Syrien 1973 mit einem Überraschungsangriff am jüdischen Feiertag Jom-Kippur zu revidieren, erlitten aber nach zweieinhalb Wochen wieder eine vernichtende Niederlage.xvii
Die Präsenz der PLO im Libanon veranlasste Israel 1982 zum Einmarsch. In Beirut ließen die IDF christliche Milizen wüten und in den Lagern Sabra und Schatila mindestens 1.000 palästinensische Flüchtlinge abschlachten.
Die Landgewinne im Sechstagekrieg ließen die Siedlerbewegung entstehen. Auf dem Golan, auf der Westbank und in Gaza wurden mit wohlwollender Duldung, später Förderung, des Staates jüdische Siedlungen errichtet. Die UN-Resolution 242, die den Rückzug aus den besetzten Gebieten forderte, wurde missachtet. Die Intifada von 1987 bis 1993 hinderte die Siedler nicht am weiteren Ausbau. 1993 waren es 120.000 – die dritte Stufe der Konflikteskalation.
Um die Lage zu beruhigen, initiierten die USA 1993 die Friedensgespräche in Oslo. Die PLO unter Arafat erkannte das Existenzrecht Israels an, erhielt dafür aber nur die Selbstverwaltung der besetzten Gebiete, die auch noch in drei Zonen mit unterschiedlichen Zuständigkeiten unterteilt waren. Die Abkommen von Oslo waren daher für die Palästinenser in jeder Hinsicht enttäuschend. Sie veranlassten Israel nicht einmal zum Stopp des Siedlungsbaus. Der wurde im Gegenteil vorangetrieben. Bis 2018 ist die Anzahl der Siedler auf über 622.000 angestiegen.xviii Das Alltagsleben in der Westbank wurde zunehmend schwierig, unter anderem wegen der durch die zahlreichen Check-Points eingeschränkten Mobilität. Deshalb bemühten sich die USA im Jahr 2000 in Camp David, den Status Palästinas zu verbessern. Aber die Verhandlungen scheiterten. An eine Zweistaatenlösung war gar nicht zu denken. Ehud Barak ließ sich so wenig darauf ein wie vorher Jitzchak Rabin.
Die Empörung über das Scheitern der Verhandlungen – dazu kam noch der provozierende Besuch des Tempelbergs durch Ariel Scharon – löste die zweite Intifada aus. Diesmal wurden die jüdischen Israelis mit zahllosen Selbstmordanschlägen, 55 allein in 2002, und später mit Raketenangriffen der Hamas stark bedroht. Israel reagierte darauf mit Massenverhaftungen, der Zerstörung der Wohnhäuser von Verdächtigen und der gezielten Tötung von Hamasführern. Nach fünf Jahren zählte man rund 1.000 tote Israelis und 3.500 tote Palästinenser. Diese vierte Eskalationsstufe ist aber ihnen zuzurechnen. Der 2001 von den USA ausgerufenen „Krieg gegen den Terror“ lieferte der israelischen Führung eine neue Rechtfertigung für hartes Vorgehen. Sie konnte sich auf das Martial Law Manual, das neue Kriegsrechtshandbuch des US-Verteidigungsministeriums berufen. Zum Schutz gegen Anschläge begann man 2003 mit dem Bau der Mauer, geplant auf 760 km Länge und verbunden mit weiterem Landraub.
Eine Friedensinitiative der Saudis im Jahr 2002 scheiterte wiederum, weil Israel den Rückzug aus den besetzten Gebieten und die Gründung eines Palästinenserstaates ablehnte. Die Israelis waren stets in dem Dilemma, dass der Friede nur mit dem Zugeständnis eines Staates für die Palästinenser zu gewinnen war. Der Titel eines Buchs von Moshe Zimmermann, erschienen 2010, heißt: „Die Angst vor dem Frieden. Das israelische Dilemma“.
2006 startete Israel eine Militäroffensive gegen die Hisbollah im Libanon, die zahlreiche Opfer unter der Zivilbevölkerung forderte. – Der zweite Libanonkrieg. Dann folgten fünf Militäroperationen in dem seit 2007 abgeriegelten Gazastreifen mit martialischen Namen. 2008 reagierte Israel auf Raketenbeschuss mit der Operation „Gegossenes Blei“. Ergebnis: bis zu 1.000 tote Zivilpersonen auf palästinensischer Seite. 2012 wieder Raketenbeschuss und Militäroperation, diesmal 160 tote Palästinenser. 2014 startete Israel nach neuen Raketenangriffen die mehrwöchige Operation „Protective Edge“ mit 2.300 Toten, davon 70 Prozent Zivilpersonen. 10.000 Menschen wurden verwundet. Israel trauerte um 64 Tote. Das Ergebnis der drei großen Angriffswellen waren über 3.800 Tote, darunter fast 1.000 Minderjährige.xix Wohnhäuser, Krankenhäuser und Schulen wurden nicht verschont. 2018, als zahlreiche meist jugendliche Palästinenser an der Grenze zu Gaza gegen ihr Freiluftgefängnis protestierten – sie nannten es „Marsch der Rückkehr“ – hatten Scharfschützen den Befehl, sie zu Krüppeln zu schießen. 2.000 Verletzte und 30 Tote. Bei einer Militäroperation im Mai 2021 kamen mindestens 248 Palästinenser (darunter 66 Kinder) und 13 Israelis um. Mehrere tausend Menschen wurden verletzt und einige Zehntausend zur Flucht gezwungen. – Die fünfte Stufe der Konflikteskalation.
Als sich übrigens Hamas und Fatah 2014 auf eine Einheitsregierung verständigt hatten – die beiden Parteien hatten sich 2006 zerstritten – ,erkannte Israel diese Regierung nicht an. Sie hätte eine moderatere Politik erwarten lassen. Die Provokationen der Hamas waren aber für Israel nützlich, weil sie ein hartes Vorgehen rechtfertigten. Jeffrey Sachs meint: Gerade verhandlungsbereite Terroristen in diesem Konflikt „enden in der Regel tot“.
Das 2018 verabschiedete Nationalstaatsgesetz machte die israelischen Bürger arabischer Herkunft zu Staatsbürgern zweiter Klasse in einer ethnisch-religiös definierten Nation, von sonstiger Rechtsungleichheit abgesehen. Das politische Spektrum in der Gesellschaft hat sich nach rechts verschoben. Das bestätigen beispielsweise Moshe Zimmermann und der Schriftsteller Yishai Sarid.xx 47 Prozent der jüdischen Israelis, also knapp die Hälfte, unterstützen nach einer Umfrage vom Frühjahr 2025 die Ausweitung der Kontrolle über die Palästinensergebiete, verstärkte Siedlertätigkeit und die Aufhebung des Autonomiestatus.xxi
Am 7. Oktober 2023 drangen nach zwei Jahren Vorbereitung bis zu 5.000 Kämpfer der Hamas und anderer Kampfgruppen in die Randzone um den Gazastreifen ein. Das heißt, sie überwanden an mehreren Stellen den Grenzzaun, zum Teil mit Ultraleichtgleitern. Die Ziele: wieder die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf Gaza zu lenken und Geiseln zum Gefangenenaustausch zu nehmen. Man muss wissen, dass Tausende Palästinenser und Palästinenserinnen, oft ohne Gerichtsverfahren inhaftiert sind. 2023 waren es 5.000, davon 1.100 ohne Anklage in „Verwaltungshaft“. Die Invasoren konnten 250 Geiseln verschleppen.
Das Buch des Schweizer Militärexperten Jaques Baud und der von Rami George Khouri und Helena Cobban, beide USA, edierte Band zeigen ein anderes Bild von der Operation der Hamas als in den Mainstreammedien verbreitet. Erstens waren demnach nicht wenig der Entführten Soldaten und Soldatinnen, also Gefangene. Getötete oder verletzte Soldaten und Sicherheitsleute wurden von Israel den wehrlosen Opfern zugerechnet. Die Operation der Hamas zielte primär auf militärische Ziele. Die israelische Abwehr war nach dem Urteil des Militärexperten Jaques Baud unkoordiniert und hektisch. Deshalb wurden zum Teil eigene Bürgerinnen und Bürger aus Panzern und Helikoptern heraus erschossen. Die israelische Regierung zählte gleich am 7. Oktober 1.400 getötete Israelis. Die Zahl wurde später zweimal nach unten korrigiert. Nach offizieller Zählung sind rund 800 Zivilpersonen umgekommen. 379 Getötete waren Angehörige verschiedener Einsatzkräfte. Die angeprangerten Gräueltaten lassen sich nicht bestätigen.
Aber kein Zweifel – es handelte sich um einen Terrorakt. Es war ein Schock für die israelische Gesellschaft, die stets glauben sollte, dass ihr Staat sie schützen könne. Der israelische Anthropologe Jeff Halper sah die „Obsession von Sicherheit“ in einem Aufsatz 2017 kritisch.xxii Eine Retraumatisierung ist angesichts der jüdischen Vergangenheit verständlich.
Die Antwort der israelischen Regierung in der Operation Eiserne Schwerter war gnadenlos. Rücksicht auf die Zivilbevölkerung gibt es nicht. Israel sperrte dem ohnehin unterversorgten Gazastreifen Lebensmittel, Wasser und Energie. Verteidigungsminister Galant am 9. Oktober: „Wir kämpfen gegen menschliche Tiere“.xxiii Entsprechend operiert die Armee, entsprechend verhalten sich die Soldaten. Es wird nicht nur der massenhafte Tod von Zivilisten in Kauf genommen. Sie werden oft gezielt erschossen, auch Kinder, auch medizinisches Personal. Siebzig Mediziner sitzen in berüchtigten Folterlagern. Soldaten posten Videos mit Opfern der entfesselten Gewalt. Wasser- und Nahrungsmangel werden zur Waffe. Tödliche Epidemien werden in Kauf genommen. Israel agiert im rechtsfreien Raum.
Die Bilanz bis März 2025: mindestens 50.000 tote Gazabewohner, 70 Prozent davon Frauen und Kinder, 40.000 Waisenkinder, 20.000 Kinder vermisst, vermutlich unter Schutt begraben.xxiv
Kaum ein Wohnhaus noch bewohnbar, die zivile Infrastruktur zerstört, unter anderem die Wasserversorgung, Brunnen gezielt unbrauchbar gemacht, Friedhöfe platt gemacht, die Krankenhäuser, Schulen, Universitäten vernichtet, Moscheen oder Kirchen, alle kulturellen Einrichtungen zerstört, das alles planmäßig. Es gibt kaum noch Grün in dieser Wüste. Auf lange Sicht wird kein gesellschaftliches Leben im Gazastreifen mehr möglich sein.
Fragen Sie nicht „Wie konnte es dahin kommen?“ Es musste dahin kommen. Die Eskalationsspirale war unausweichlich. Die vorbehaltlose Unterstützung Israels durch die westliche Wertegemeinschaft hat dem Rechtsnihilismus Vorschub geleistet.
_______________________________________________________________________________
Wichtige Stationen in der Geschichte des Konflikts sind meines Erachtens:
ab 1920 Beginn der Besiedlung, ab den 1930er Jahren verstärkt durch die Flucht aus Europa, erster militanter Widerstand der Palästinenser
1947/48 UNO-Teilungsplan, ethnische Säuberung und Staatsgründung
1967 Eroberung und Besetzung des Westjordanlandes, neue Siedlerbewegung, erste Intifada
1993 bis 1995 Abkommen zwischen Arafat/ der PLO und Rabin ohne Eigenstaatlichkeit für die Palästinenser
2000 bis 2005 zweite Intifada
ab 2006 Übergang zu einem heißen Krieg (Militäroffensive gegen die Hisbollah, Abriegelung des Gazastreifens, wiederholte Militäroperationen am Boden und in der Luft als Reaktion auf Raketenbeschuss durch die Hamas)
2018 Nationalstaatsgesetz verabschiedet (Israel ein jüdischer Staat)
ab 2023 nach Überfall der Hamas Zerstörung der Gaza-Städte, Terror der Siedler, Libanonkrieg
Georg Auernheimer
_____________________________________________________________________________
iMeir Kahane, geb. 1932, ein Rabbiner aus Brooklyn, gründete 1971 die Kach-Partei, die ein Großisrael anstrebte und die Vertreibung der Araber mit Gewalt propagierte.
iiDie israelische Soziologin Eva Illouz im Interview, in: der Freitag Nr. 41 v. 10.10.2024
iiiMathias Delori: Der Körper als Metallstück. In: Le Monde diplomatique 03/2025, S.9
ivZitiert nach Martin Dieckmann: Internationalismus als permanente Provokation. „Matzpen“ in Israel. In: Lunapark21, H.64 (1/25), S.16
vZitiert nach Alain Gresh: Gaza – die alte Fantasie von der Vertreibung. In: Le Monde diplomatique 03/2025, S.1
viZitiert nach Jaques Baud 2024, S.336
viiDie Krise des internationalen Strafrechts. In: junge Welt v. 07.04.25, S.12
viiiJaques Baud 2024, S.85 ff.
ixHerzig 1997, S.186
xNach Edward Said 1981, S.80
xiZitiert nach Gudrun Krämer 2002, S.131
xiiIn einem Memorandum für die Regierung versichert er 1919: „In Palästina denken wir nicht daran, die Wünsche der gegenwärtigen Bevölkerung (also der arabischen Bevölkerung, G.A.) zu konsultieren.“ Zitiert nach Heiko Flottau 2024, S.
xiii Der Plan wurde von den Palästinensern abgelehnt. Ein Jahr später schlug eine andere britische Kommission einen gemeinsamen Staat für Juden und Araber vor. Er wurde von den Zionisten abgelehnt.
xivNach Gudrun Krämer (2002) sollen es sogar 67 Prozent der Bevölkerung gewesen sein.
xv Zitiert nach Ilan Pappe 2007, S.46.
xviIn beiden Dörfern wurden zahlreiche Menschen ermordet, in Tantura über 200 vorwiegend wehrfähige Männer (Krämer 2002, Gorenberg 2012). Generell wurden als feindselig denunzierte Palästinenser exekutiert.
xvii Die Zahl ihrer Gefallenen war zehnmal größer als die Israels.
xviii Nach Jaques Baud 2024, S.53
xix Khalidi 2024, S. 266. Im Goldstone-Bericht wurde die israelische Politik 2009 angeprangert.
xxSarid: „Ich bin ein Linker, kein Idiot“ in: der Freitag Nr.6 v. 06.02.2025, S.17
xxiJunge Welt v. 14.03.2025, S.3
xxiiHier wird mehr exportiert als nur Waffen. In: Groth, A. u.a. (Hg.) (2017): Palästina – Vertreibung, Krieg und Besatzung. Köln.
xxiiiInfosperber am 14.10.2023, https://www.infosperber.ch/politik/welt/israels-verteidigungsminister-wir-kaempfen-gegen-tiere/
xxivNesrine Malik in: der Freitag Nr.6 v. 06.02.2025
Literatur:
Achcar, Gilbert (2012): Die Araber und der Holocaust. Hamburg: Edition Nautilus.
Baud, Jaques (2024): Die Niederlage des Siegers. Frankfurt/M.: Westend Verlag.
Böhm, Omri (2024): Ein Waffenstillstand ist ein Gebot der Stunde. In: Die Zeit v. 25.01.24
Cobban, Helena/Khouri, Rami G. (Ed.) (2024): Understanding Hamas: And Why That Matters. New York: OR Books.
Flottau, Heiko (2024): Von Herzl bis Hamas. Am 7. Jan. 24 in Journal21.ch
Gorenberg, Gershom (2012): Israel schafft sich ab. Frankfurt/M.: Campus.
Gresh, Alain (2025): Gaza – die alte Fantasie von der Vertreibung. In: Le Monde diplomatique 03/2025.
Grossmann, David (2024) im Interview mit Julia Encke zu Israel und Zweistaatenlösung. In: F.A.S. v. 21.01.24
Herzig, Arno (1997): Jüdische Geschichte in Deutschland. München: Beck Verlag.
Khalidi, Raschid (2020): Der hundertjährige Krieg um Palästina. Eine Geschichte von Siedlerkolonialismus und Widerstand. Zürich: Unionsverlag.
Krämer, Gudrun (2002): Geschichte Palästinas. 2. Aufl. München: Beck Verlag.
Pappé, Ilan (2007): Die ethnische Säuberung Palästinas. Frankfurt/M.: Zweitausendeins.
Sachs, Jeffrey (2025): Wie die USA und Israel Syrien zerstörten – und es Frieden nannten. In: Free21 Magazin, 12. Jg, Jan. 2025, S.23-26.
Said, Edward (198): Zionismus und palästinensische Selbstbestimmung. Stuttgart: Klett-Cotta.
Traverso, Enzo (2024): Gaza im Auge der Geschichte. Wirklichkeit Books.
Wiedemann, Charlotte (2023): Das Trauma von 1948. In: Le Monde diplomatique (dt.) Jan. 2023, S.12/13.