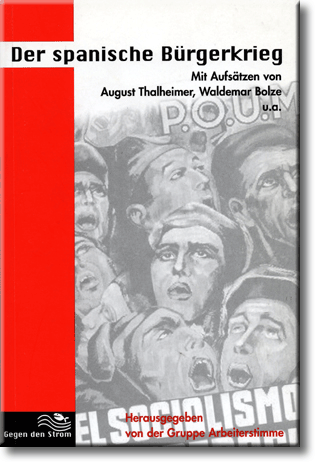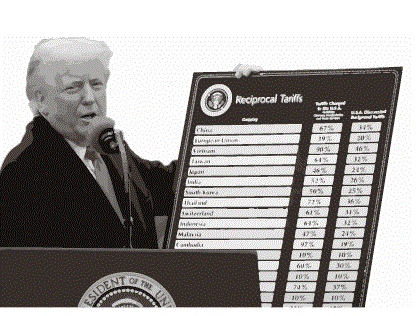Seit seinem Amtsantritt zur zweiten Präsidentschaft ist Donald Trump dabei, einschneidende Korrekturen an der bisherigen Politik der USA umzusetzen, mit am spektakulärsten bei der Zollpolitik. Meistens geschieht das in typischer Trump-Manier, mit radikalen Ankündigungen, deren baldige Aussetzung, Verhandlungen über Deals, begleitet von neuen Drohungen usw.. Diese Politik wird oft als erratisch und chaotisch bezeichnet, eine Kennzeichnung, die durchaus ihre Berechtigung hat. In den hiesigen Medien liest man häufig Wortmeldungen von Ökonomen, die erklären, wie schädlich die Zölle für die Weltwirtschaft wären, auch den Amerikanern selbst würden sie keineswegs nützen. Dieser Kritik kann man, zumindest in vielen Fällen, eine Berechtigung nicht absprechen.
Trumps Politik ist sicher nicht frei von Widersprüchen und er handelt nicht kohärent im Sinne einer ökonomischen Schule. Trotzdem folgt das Agieren Trumps einer Logik und basiert auf einer Interpretation der US-amerikanischen Interessen. Das soll im folgenden aufgezeigt werden.
Die internationalen ökonomischen Rahmenbedingungen
Für eine Auseinandersetzung mit dem Handeln Trumps ist es sinnvoll, zuerst einen Blick auf die ökonomische Weltlage zu werfen. Dort sind seit einiger Zeit wichtige Veränderungen zu beobachten, dazu zählen vor allem der Aufstieg Chinas und die sich daraus ergebenden Verschiebungen der weltpolitischen Lage. China ist bekanntlich inzwischen, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in US-Dollar (umgerechnet zu den aktuellen Wechselkursen) nach den USA die zweitgrößte Volkswirtschaft. Wird mittels Kaufkraftparität umgerechnet, hat China die USA bei der Wirtschaftsleistung bereits überholt. Gleichzeitig wird China auch bei technisch anspruchsvollen Produkten immer stärker. Chinesische Produzenten werden in steigendem Ausmaß zu Konkurrenten der Hersteller in den kapitalistischen Metropolen, wo bis vor kurzem die Produktion von Gütern der Hochtechnologie fast ausschließlich konzentriert war.
Zum Verständnis der Situation gehört auch, sich zu vergegenwärtigen, unter welchen Bedingungen sich der Aufstieg Chinas vollzogen hat. Im wesentlichen war das eine Zeit der Vorherrschaft der neoliberalen Ideologie in der „westlichen“ Welt. Die Entwicklung in China fand statt unter den Bedingungen des Freihandels, einer weitgehenden Freiheit des Kapitalverkehrs, der rasch voranschreitenden Globalisierung mit dem damit verbundenen Anwachsen des internationalen Handels, der immer komplizierter werdenden Lieferketten über Ländergrenzen hinweg, der fortschreitenden internationalen Arbeitsteilung usw..
Es bleibt weiter festzuhalten: die westlichen Mächte unter der Führung der USA haben diese „neoliberale Weltordnung“ über Jahrzehnte hin aktiv angestrebt und auch gegen Widerstände durchgesetzt. Als ein typisches Element dafür sei die Welthandelsorganisation (WTO, World Trade Organization,) genannt, deren Regeln einen möglichst umfassenden Freihandel mit niedrigen oder besser gar keinen Zöllen beinhalten. China wurde 2001 in die WTO aufgenommen. In den USA bestand diesbezüglich lange Zeit ein Konsens zwischen den Demokraten und den Republikanern. Präsidenten beider Parteien haben diese Politik mitgetragen und vorangetrieben.
Von den einschlägigen Propagandisten wurde diese Entwicklung als ein Erfolg des Neoliberalismus und ganz allgemein der kapitalistischen Welt in Anspruch genommen. Mit Stolz verwies man auf den weltweit stark zunehmenden Handel, auf die großen Investitionen westlicher (auch deutscher) Firmen in China, auf das Wachstum des weltweiten BIP und auf die Abnahme der absoluten Armut in der Welt. Das kapitalistische System wurde dabei als Erfolgsgeschichte und als völlig alternativlos dargestellt.
Und jetzt brechen die USA mit dieser Linie. Denn Zollerhöhungen in großem Ausmaß entsprechen eindeutig nicht den Regeln des Neoliberalismus. Die Wende wird von einer konservativ-rechten. vom Kapital unterstützten Regierung vollzogen. Dabei waren das rechte Lager und das Kapital bisher die stärksten Bastionen des Neoliberalismus. Wie ist das zu erklären?
Zuerst gilt es festzuhalten, die Realität entsprach nie dem propagandistischen Idealbild. Es gab z.B. den „Schönheitsfehler“, dass der Löwenanteil des globalen Wachstums nicht in der „freien Welt“, sondern im „kommunistischen“ China generiert wurde. In den kapitalistischen Metropolen blieb das Wirtschaftswachstum dagegen meistens eher bescheiden. Hier konnte der Neoliberalismus sein Versprechen auf Entfesselung des Wachstums nicht einlösen. Darüber hinaus brachte die Globalisierung eine Reihe von negativen Nebenwirkungen. Sie kostete in den Metropolen viele Arbeitsplätze. Aus manchen Ländern verschwanden vollständige Industriezweige.
Aber es gibt noch einen anderen wichtigen Aspekt. Der Neoliberalismus ist eine Ideologie, die in ihrer Reinform eigentlich von der staatlichen Verfasstheit der kapitalistischen Länder abstrahiert. Der Bezugspunkt des Neoliberalismus ist in gewisser Weise ein internationaler Kapitalismus, weltweit und grenzenlos.
Aber es gibt natürlich die Staaten und diese übernehmen im Kapitalismus unter anderem auch eine Funktion, die in der marxistischen Diskussion als „ideeller Gesamtkapitalist“ bezeichnet wird. Der zum reinen Neoliberalismus passende ideelle Gesamtkapitalist wäre ein überstaatlicher ideeller Weltkapitalist. Klar ist aber, für so einen gedachten ideellen Weltkapitalisten gibt es keine passende Institution. Es gibt keinen Weltstaat.
Was wir in den vergangenen Jahrzehnten erlebt haben, war eine weitgehende Deckungsgleichheit der Interessen eines gedachten Weltkapitalismus mit denen der entwickelten kapitalistischen Länder, angeführt von den USA. Selbstverständlich war die Deckungsgleichheit nie vollständig. Punktuell gab es häufige und vielfältige Abweichungen von Einzelinteressen. Aber in der großen Linie bestand Übereinstimmung. Was dem Weltkapitalismus nützte, nützte auch den USA und in ihrem Schlepptau auch den anderen kapitalistischen Metropolen. Dem entsprach auf ideologischem Gebiet die Vorherrschaft des Neoliberalismus. Das passte natürlich hervorragend in eine Zeit mit schnell voranschreitender Globalisierung.
Aber die Lage hat sich geändert. Die Deckungsgleichheit der Interessen eines Weltkapitalismus mit denen der USA hat sich aufgelöst. Die Hauptursache dafür ist der Aufstieg Chinas. Dieser stellt zunehmend die Hegemonie der USA in Frage, sowohl wirtschaftlich wie auch machtpolitisch. Sicher, noch sind die USA eine sehr starke Wirtschaftsmacht, die stärkste Militärmacht sowieso, gleichzeitig ist aber eine Relativierung ihrer Hegemonie unübersehbar. Das erfordert Reaktionen, um der allmählichen Aushöhlung der Machtposition etwas entgegenzusetzen. Reaktionen, die auch mit lange Zeit hochgehaltenen Prinzipien wie dem Freihandel brechen können. Wenn die eigene Stellung als Hegemon in Gefahr ist, kann auch die propagierte Ideologie in Frage gestellt werden. Das bedeutet nicht, dass der Neoliberalismus völlig verworfen wird, er verliert aber in wichtigen Aspekten seine Verbindlichkeit.
Zu beobachten ist eine Neuausrichtung der US-Politik, es beginnt eine neue Phase in der Weltpolitik. Damit sind aber noch nicht die Mittel festgelegt, die zum Einsatz kommen. Auch die Sache selbst, nämlich die weitere Entwicklung des Kapitalismus und die Sicherung der hegemonialen Stellung der USA, ist damit noch keineswegs entschieden.
Versuche, China einzudämmen
Ein erster Politikwechsel wurde bereits unter Präsident Obama mit der damals proklamierten Strategie der „Hinwendung nach Asien“ („Pivot to Asia“) eingeleitet. Trump hat in seiner ersten Amtszeit den Kurs der Eindämmung Chinas fortgesetzt. Allerdings hat er ein von Obama zu diesem Zweck geplantes Instrument, nämlich die Freihandelszone TPP mit vielen asiatischen und nord- und südamerikanischen Mitgliedern, aber ausdrücklich ohne China, nicht fortgesetzt. Trump kündigte gleich zu Beginn seiner Amtszeit dieses Abkommen, es wurde dann als CPTPP ohne die USA weitergeführt. Biden wiederum hob die von Trump gegen China verhängten Zölle und Handelsbeschränkungen nicht auf, sondern konkretisierte und verschärfte letztere noch weiter. Es ist sicher kein Zufall, wenn in der Politik gegen China die größte Kontinuität zwischen Republikanern und Demokraten bzw. zwischen der Biden- und der Trump-Administration besteht, auch wenn sie sich teilweise unterschiedlicher Mittel bedient haben und noch bedienen.
Die Demokraten waren während ihrer Regierungszeit darauf bedacht, trotz der versuchten Eindämmung Chinas das System des Freihandels möglichst zu erhalten. Sie haben eher die Kreise vertreten, die mit zu den Gewinnern des Freihandels gehörten. Zu ihrem Konzept gehörte es auch, eine breite Einbindung der Verbündeten anzustreben. Dies schließt eine gewisse Rücksichtnahme auf deren Interessen ein. Die negativen Folgen der Globalisierung haben sie eher kleingeredet oder für unvermeidlich erklärt. Ein Grund für ihre Vorgehensweise war vermutlich die Absicht, Risiken für die Weltwirtschaft und damit auch für die US-Wirtschaft zu vermeiden.
Trump und die MAGA Bewegung greifen dagegen die negativen Folgen der Globalisierung aktiv auf. Sie werfen den Demokraten, speziell der Regierung Biden ein völliges Versagen auf diesem Gebiet vor. Angesagt ist deshalb nicht die Fortsetzung der herkömmlichen Politik, sondern ein deutliches Kontrastprogramm. Sie beklagen eine bereits eingetretene Schwächung der Macht der USA. Um diesen Schaden wieder zu beheben, geht es für sie beileibe nicht nur um die Politik China gegenüber. Ein viel radikalerer Kurswechsel sei erforderlich. Eben „America first“, die Interessen der USA müssten in allen Belangen wieder an erster Stelle stehen.
Das Aufkommen der MAGA Bewegung hat selbstverständlich auch viele gesellschaftliche und innenpolitische Gründe und lässt sich nicht allein auf die genannten weltpolitischen Verschiebungen zurückführen (siehe Arsti Nr. 228: „Trump und der Rechtspopulismus in den USA“).
Die ökonomische Lage der USA
Festgemacht wird der Niedergang von Macht und Dominanz der USA am Abbau von industriellen Arbeitsplätzen, der in den USA etwa ab 1980 stattgefunden hat. Die Tatsache als solche ist unbestritten. Weil die verlorenen Jobs zahlenmäßig durch neue im Dienstleistungsbereich ausgeglichen wurden, wurde der Umbau von vielen Ökonomen nicht als echtes Problem gesehen, sondern eher als unvermeidliche Entwicklung, die mehr oder weniger auch in den anderen reifen Industrieländern festzustellen war. Von manchen wurde die Verschiebung von der Industrie hin zu Dienstleistungen sogar als Zeichen für die Modernität der US-Wirtschaft gewertet.
Allerdings ist unbestreitbar, dass viele der neuen Jobs im Dienstleistungsbereich schlecht bezahlt sind. Genauso wie die Globalisierung auch Landstriche geschaffen hat, die sich nach dem Untergang der früher florierenden Industrien im Niedergang befinden und für die dort Ansässigen kaum mehr Perspektiven bieten.
Mehr oder weniger parallel zum Rückgang der industriellen Arbeitsplätze hat sich ein chronisches Handelsbilanzdefizit der USA aufgebaut. Eines der dafür „verantwortlichen“ Länder ist China. Viele der preisgünstigen Waren auf dem US-amerikanischen Markt kommen aus diesem Land. Die beständig gestiegene Einfuhr dieser Waren war auch ein Grund für die relative Preisstabilität in der Vergangenheit (bis zur Corona-Pandemie). Aber die Importe aus China bestehen inzwischen nicht mehr nur aus vormals typischen Billigprodukten, sondern sie umfassen immer mehr moderne, technisch anspruchsvolle Waren. Viele Vorprodukte, die von US-Herstellern weiterverarbeitet werden, kommen aus China. Ohne ihren ständigen Nachschub würde die US-Produktion vieler Güter zum Erliegen kommen. Dazu kommen Abhängigkeiten bei bestimmten Rohstoffen wie etwa den Seltenen Erden, bei deren Aufbereitung China sich eine sehr starke, fast monopolartige Stellung erarbeitet hat.
Handelsbilanzdefizite weisen die USA nicht nur gegenüber China aus, sondern auch gegenüber einer Reihe anderer Staaten. Darunter sind nicht nur typische Niedriglohn-Länder wie etwa Vietnam oder Bangladesh zu finden, sondern auch Länder, die zu den kapitalistischen Metropolen zählen, wie Japan, die EU mit einem erheblichen Anteil Deutschlands und Südkorea. Eine besonders enge Verflechtung besteht mit den Nachbarländern Kanada und Mexiko, die mit den USA mit dem (von Trump in seiner ersten Amtszeit als Nachfolge für NAFTA ausgehandelten) Freihandelsabkommen USMCA (United States-Mexico-Canada-Agreement) verbunden sind.
Selbstverständlich sollte man mit schnellen Urteilen nach dem Motto „Handelsdefizit bedeutet wirtschaftliche Schwäche“ vorsichtig sein. Es geht bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht allein um den Handel mit gegenständlichen Waren. Dienstleistungen und andere ökonomische Aktivitäten müssen genauso einbezogen werden. Auch die Innovationsfähigkeit spielt eine wichtige Rolle. Unter dem Begriff Dienstleistungen werden sehr vielfältige Aktivitäten zusammengefasst. Damit erzielen die USA gegenüber vielen Ländern positive Bilanzen. Sie sind dort auch mit starken, modernen Anbietern vertreten. Man denke nur an Konzerne wie Meta, Amazon und Google, an „Künstliche Intelligenz“ und ähnliches. Für das Kapital ist entscheidend, wie es sich verwerten kann und wie viel Profit anfällt. In welchen Sparten das im einzelnen stattfindet, ist zweitrangig.
Wenn aber ein Defizit seit vielen Jahren besteht und eine bedeutende Größe aufweist, wenn es weiterhin bei technisch hochstehenden und nach allgemeiner Einschätzung für die Zukunft wichtigen Produkten vorhanden ist, kann das schon auf nachlassende Konkurrenzfähigkeit hinweisen. Nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 70er Jahre waren die Verhältnisse jedenfalls noch ganz anders. Es gab damals kein Handelsdefizit und der Anteil der USA an der Weltindustrieproduktion ebenso wie am Welthandel war um einiges größer als heute.
Auch in den USA hat nach Jahren relativer Preisstabilität, ausgelöst durch die Unterbrechung der Lieferketten während der Corona-Pandemie, ein Inflationsschub eingesetzt. Dieser wurde durch die Nachfrage steigernden Maßnahmen der ersten Trump- wie auch der Biden-Regierung angeschoben und verlängert. Die Preissteigerungen haben wahrscheinlich mit zur Niederlage der Demokraten bei den Präsidentschaftswahlen 2024 beigetragen. Denn sie waren schwerpunktmäßig während der Biden-Zeit zu spüren und wurden überwiegend seiner Regierung angelastet. Die Inflationsrate ist inzwischen wieder gesunken. Die niedrigsten Preissteigerungen der letzten Jahre gab es im April 2025 mit 2,3%, für Juni und Juli 2025 wurden je 2,7 % gemeldet. Die Situation ist nicht dramatisch, sie bleibt aber fragil. Es bedarf keiner großen Anstöße, um die Preise wieder schneller steigen zu lassen.
Die Staatsverschuldung der USA hat bereits ein erhebliches Ausmaß erreicht. Zum 27. Mai 2025 betrug sie laut US-Treasury (Schatzamt) 36,9 Billionen (das sind 36 900 Milliarden) US-Dollar. Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ergibt das einen Verschuldungsgrad von etwas über 120%. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass das Staatsdefizit auch in Zukunft erheblich sein wird. Die Verschuldung wird weiter zunehmen.
Noch haben die USA haben kein generelles Problem, ihr Haushaltsdefizit zu finanzieren, auch wenn manche Stimmen vor einer drohenden Schuldenkrise warnen. Sie müssen bereits höhere Zinsen für ihre Schulden bezahlen als etwa Deutschland (bei 10-jährigen Staatsanleihen USA 4,23%, BRD 2,68%, Stand 14.08.2025). Der Posten für Zinszahlungen ist inzwischen größer als das im Staatshaushalt ausgewiesene Budget für das Militär.
Nach allgemeiner Ansicht ist der Status des Dollar als internationaler Reservewährung bei der Schuldenfinanzierung für die USA sehr hilfreich. Aber auch das wird im MAGA Lager in Frage gestellt, genauso wie die derzeitige Höhe des Dollarkurses. Stephen Miran, der ökonomische Chefberater des Weißen Hauses, hat im November 2024 ein Papier vorgelegt, in dem er die Rolle des Dollar als Leitwährung problematisiert und sich für einen generell niedrigeren Dollarkurs ausspricht. (https://www.hudsonbaycapital.com/documents/FG/hudsonbay/research/638199_A_Users_Guide_to_Restructuring_the_Global_Trading_System.pdf)
Die Wirtschaftspolitik Trumps
Auch auf ökonomischem Gebiet hat Trump im Wahlkampf großzügige Versprechungen gemacht. Gemäß dem Slogan „Make America Great Again“ wird die Zukunft selbstverständlich großartig und golden werden. Die USA sollen wirtschaftlich erstarken und allen soll es dann besser gehen.
Neben dieser Propaganda gab es auch einige konkretere Aussagen. So z.B. das Versprechen, die zwei für die USA zentralen Sozialleistungen, „Social Security“ (staatliche Renten) und „Medicare“ (Krankenversicherung für über 65-Jährige), nicht anzutasten. Nicht eingeschlossen in dieses Versprechen war dagegen „Medicaid“, die staatliche Krankenversicherung für Bedürftige.
Versprochen wurden auch stabile Preise, Entlastung bei den Steuern und Deregulierungen. Ein wichtiger Teil dieser Versprechungen wurde aus der Sicht Trumps im Haushaltsgesetz, das am 3. Juli 2025 endgültig verabschiedet wurde, umgesetzt (siehe das„Big Beautifull Bill“).
Während der Regierungskurs der Demokraten eher von Vorsicht und der Vermeidung von Brüchen geprägt war, gehen Trump und die MAGA Bewegung viel radikaler vor. Sie nehmen größere Risiken in Kauf und scheuen nicht vor einschneidenden Veränderungen zurück. Sie sind viel rücksichtsloser, auch gegenüber Verbündeten. Drohungen und Erpressungen sind für sie völlig normale Mittel, die nicht mehr beschönigt oder maskiert werden müssen.
Das chronische Handelsbilanzdefizit der USA wird durch Trump völlig neu bewertet und zu einem, wenn nicht dem entscheidenden wirtschaftlichen Hauptproblem der USA erklärt. Die Zollpolitik ist geradezu auf die Handelsbilanz fixiert. Dabei geht es um das Handelsbilanzdefizit ganz generell, egal ob es gegenüber Verbündeten oder gegenüber Rivalen besteht, ob es etwa durch High-Tech- oder durch Low-Tech-Produkte verursacht wird. Außerdem hat MAGA das große Ziel einer Reindustrialisierung der USA ausgerufen. In der Industrie sollen viele neue und gut bezahlte Jobs entstehen. Ein Versprechen, das sich vor allem an seine Wähler aus der Arbeiterklasse richtet.
Das wichtigste Mittel, um all diese Ziele zu erreichen, soll die Zollpolitik sein. Das „Projekt 2025“ der „Heritage Foundation“ ( https://www.project2025.org ) war noch unentschieden und enthielt nebeneinander Beiträge, die pro Zollerhöhung bzw. pro Freihandel argumentierten. Inzwischen ist aber offensichtlich die Entscheidung gefallen. Hohe Zölle sollen das zentrale Mittel für die ökonomische Agenda sein.
Welche Mittel neben der Zollpolitik sonst noch eingesetzt werden könnten, ist weniger klar. Eine industriepolitische Strategie, die bei dieser Zielsetzung eigentlich naheliegend wäre, ist kaum erkennbar und widerspricht wohl auch der vorherrschenden Ideologie von MAGA. Es gibt einzelne Aktionen wie etwa die Ankündigung von großen (privaten) Investitionen für KI-Rechenzentren (Projekt „Stargate“) oder die Staatsbeteiligung beim kriselnden Chipproduzenten Intel. Das sind aber Einzelaktionen.
Steuersenkungen für Besserverdienende und Reiche wurden bereits umgesetzt. Eine Senkung der Gewinnsteuern (Körperschaftssteuer) und verbesserte Abschreibemöglichkeiten für Firmen sollen noch folgen. Das Kapital wurde von Umwelt- und Klimaauflagen entlastet. Dagegen müssen die vielen gut bezahlten Industriejobs erst noch entstehen. Dass Deregulierungen und Steuersenkungen für die Reichen die Investitionen erhöhen und damit Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze schaffen, ist ein altes Versprechen des Neoliberalismus, das aber bisher nirgends wirklich funktioniert hat. Bei Trump wird dieses (neoliberale) Konzept nun ergänzt durch den (in keiner Weise neoliberalen) Glauben, mittels Zöllen die Wirtschaft der USA in großem Stil und in jeglicher Hinsicht stärken zu können, zum Nachteil aller anderen Länder, denen Zölle und neue Regeln aufgezwungen werden.
Eine deutliche Mehrheit der Mainstream-Ökonomen steht diesem Vorhaben sehr kritisch gegenüber. Sie verweisen auf die negativen Auswirkungen von Zöllen. Es drohen, so ihr Einwand, Gefahren für die Preisstabilität, eine Isolierung der USA als eine durch Zölle geschützte Hochpreisinsel und langfristig ein Verlust von Konkurrenzfähigkeit, keineswegs aber deren wirtschaftliche Stärkung.
Trump ignoriert diese Kritik und geht mit seiner Politik eine Wette ein. Er setzt darauf, dass die strikte und rücksichtslose Durchsetzung seiner Vorstellungen die Lage der USA verbessern und damit eine Basis schaffen wird, um auch seine sonstigen Versprechen erfüllen zu können. Vielleicht nicht vollständig und perfekt, aber zumindest so weit, dass er es als Erfolg verkaufen kann.
Das neue Zollregime der USA
Am 2. April 2025, dem von Trump zum „Liberation Day“ ernannten Datum, wurde ein völlig neues Zollsystem vorgestellt. Der Kern des neuen Systems besteht darin, die Höhe der Zölle für die einzelnen Länder aus den bilateralen Handelsbilanzdefiziten der USA gegenüber diesen Ländern abzuleiten. Für Länder, denen gegenüber die USA nur ein geringes oder gar kein Handelsbilanzdefizit ausweisen, wurde ein Basiszollsatz von 10 % festgesetzt. Bereits nach wenigen Tagen wurden die neuen Zölle wieder für 90 Tage ausgesetzt. Nur der Basiszoll von 10% blieb, wie auch die schon vorher angekündigten Zölle auf Autos und Autoteile, auf Stahl und Aluminium.
Es folgten Verhandlungen mit den Handelspartnern, eine weitere Verschiebung der Frist und ab 7. August traten dann die neuen Zolltarife in Kraft. Mit einigen Ländern wurden vorher sogenannte Deals abgeschlossen (für die EU, Japan und Südkorea gelten 15%, für Indonesien 19%, für Taiwan und für Vietnam 20%). Bei vielen anderen Ländern wurden die Zölle einseitig von den USA bestimmt. Besonders hart traf es Brasilien (Zollerhöhung als Strafe für das juristische Verfahren gegen den Ex-Präsidenten Bolsonaro) und Indien (Sanktionierung des Kaufs von russischem Erdöl) mit jeweils 50%.
Bei allen bisher abgeschlossenen Deals hat sich Trump in der Zollfrage mit seinen Vorstellungen sehr weit durchsetzen können. Mit der EU wurden letztlich 15% Zoll festgesetzt, statt der 20% wie ursprünglich angekündigt. Aber 15% auf fast alles ist gegenüber den vorher geltenden Tarifen (laut EU waren das im gewichteten Durchschnitt über alle Waren gerechnet etwa 1%) eine starke Anhebung. Als „Verhandlungs-“Erfolg der EU kann gewertet werden, dass die Sonderzölle auf Autos und Autoteile (insgesamt 27,5%) wegfallen und auch für diese Produkte 15% gelten. Die Zölle auf Stahl und Aluminium (50%) bleiben dagegen weiter bestehen. Ein offiziell kommuniziertes Gefühl der Zufriedenheit über den erzielten Deal konnte nur deshalb aufkommen, weil noch höhere Zollsätze angedroht waren und am Beispiel Schweiz mit 39% auch exekutiert wurden. Der ursprüngliche Gegenvorschlag der EU, die gegenseitige Abschaffung aller Industriezölle, stand nie ernsthaft zur Debatte. Jetzt werden die Zölle auf Industriewaren zwar abgeschafft, aber nur einseitig für die Exporte der USA in die EU. Den Europäern wurden tatsächlich die Grenzen aufgezeigt und sie mussten klein beigeben. Letztlich ging es nur noch um Schadensbegrenzung. Den anderen wichtigen Handelspartnern der USA erging es mehr oder weniger ähnlich.
Mit China gibt es noch keinen Deal, nur eine Art Stillhaltevereinbarung. Im April reagierte China auf die von Trump verhängten Zölle umgehend mit Gegenzöllen. Da die USA sofort mit weiteren Zöllen antworteten, waren schnell 145% (der USA gegenüber China) erreicht. Damit war der Handelskrieg eröffnet. Im Mai wurde dann ein Waffenstillstand vereinbart (mit vorläufig 30%), wobei es für einige wichtige Produkte (Laptops, Smartphones) Ausnahmen gibt. China versprach beschleunigte Genehmigungen für Exportlizenzen bei seltenen Erden. Anfang August wurde die Frist zum Aushandeln eines Deals um weitere 90 Tage verlängert.
Auch für Mexiko wurde die Frist 90 Tage verlängert. Bis dahin gilt ein Zoll von 25%. Gegen Kanada wurden 35% verfügt, angeblich wegen zu geringer Kooperationsbereitschaft. Für beide Länder besteht aber noch das Freihandelsabkommen USMCA von 2020, so dass für viele Waren keine Zölle anfallen.
Die Zolltarife begleitend wurden in allen bisherigen Deals auch weitere Bringleistungen der Vertragspartner ausgehandelt, sprich Investitionen in den USA oder Einkäufe (Energieträger, Flugzeuge) von dort. Beim Deal mit der EU ist bei den Investitionen von 600 Milliarden Dollar und bei den Einkäufen (vor allem Energieträger) von 750 Milliarden innerhalb der nächsten drei Jahre die Rede.
Unklar bleibt bis jetzt die rechtliche Qualität der Deals, da es sich dabei keineswegs um Handelsverträge im herkömmlichen Verständnis mit präzisen Regelungen bis in die Details handelt. Es sind eher lose Übereinkommen und Absichtserklärungen. Die genannten Zahlen für Investitionen und Einkäufe sind oft nicht besonders plausibel. Wenn man z.B. die (beim Deal mit der EU) angekündigten Käufe von Energieträgern mit den realen Käufen ab 2023 vergleicht, müsste eine Steigerung auf etwa das Dreifache stattfinden. Bei den Investitionen ist unklar, was alles als Investition gilt. Die meisten werden dabei an echte, produktive Investitionen denken. Oder zählt auch der Kauf von US-Staatsanleihen und Aktien zu den Investitionen, was dem üblichen Sprachgebrauch der Wirtschaft durchaus entsprechen würde? In der schriftlichen Vereinbarung gibt es jedenfalls keine klare Regelung dieser Frage. Solche Unbestimmtheiten werden zwangsläufig zu unterschiedlichen Interpretationen und neuen Differenzen führen. Bombastische Zahlen eignen sich gut für grandiose Erfolgsmeldungen, danach kann man sie vergessen, die öffentliche Aufmerksamkeit springt schnell zu neuen Themen. Bei Bedarf könnte man aber auch wieder darauf zurückkommen und z.B. neue Strafzölle mit einem Ausbleiben der Investitionen begründen.
Es war lange unklar, was eigentlich das prioritäre Ziel der Zollpolitik Trumps ist. Nach der schnellen Aussetzung der am Liberation Day angekündigten hohen Zollsätze schien noch die Einschätzung denkbar, diese sollten vor allem Drohgebärde und Verhandlungsmasse sein und weniger das wirklich angestrebte Ziel.
Inzwischen ist es klar, die USA errichten gegenüber allen wichtigen Handelspartnern hohe Zollmauern. Ein Basis-Zoll von 10% gilt grundsätzlich, Länder mit positiven Handelsbilanzen gegenüber den USA treffen deutlich höhere Zölle. Damit ist die Ära des Freihandels für die USA definitiv zu Ende. Diese Aussage lässt sich machen, auch wenn die Zoll-Deals keineswegs als klar, stabil und lang andauernd eingestuft werden können.
Es hat den Anschein, dass die Steigerung der Staatseinnahmen ein Hauptziel der Zollpolitik ist. Dafür spricht vor allem der einheitliche Zollsatz. Wäre eine Produktionsverlagerung das Hauptziel, wären unterschiedliche Tarife naheliegend, mit höheren Zollsätzen auf den Produktgruppen, bei denen eine Verlagerung besonders erwünscht ist bzw. als realistisch eingeschätzt wird.
Trump braucht höhere Einnahmen für eine (auch nur teilweise) Gegenfinanzierung seiner Steuersenkungen. Das Haushaltsdefizit soll nicht zu sehr in die Höhe getrieben werden. Laut ersten Schätzungen, die kursieren, könnten die Mehreinnahmen durch die Zölle etwa 350 bis 500 Milliarden Dollar pro Jahr betragen. Diese Summe erscheint auf den ersten Blick riesig, muss aber in Bezug auf das BIP und die sonstigen ökonomischen Kennzahlen der USA gesehen werden. Damit relativiert sie sich. Sie entspricht z.B. nur einem Fünftel bis einem Viertel des letztjährigen Defizits des Staatshaushalts.
Hohe Zolleinnahmen sind gut für die Staatskasse. Für die US-Verbraucher bringen sie die Gefahr, die Zeche bezahlen zu müssen, weil die Preise wieder schneller nach oben gehen. Ein Szenario, das kurz und mittelfristig von steigenden Preisen in den USA ausgeht, ist sehr wahrscheinlich. Steigende Preise könnten den Unmut der Anhänger Trumps erregen und ihn politisch unter Druck setzen. Aber bei der Lage der Dinge sollte man nicht allzu viel erwarten, was eventuelle politische Auswirkungen angeht. Der Hauptgrund dafür liegt in der relativ geringen Importabhängigkeit der USA. Laut Statista lag der Anteil aller Importe am US-amerikanischen BIP 2023 bei 13,89 %. Auch wenn man unterstellt, dass die Zölle weitgehend über höhere Preise weitergegeben werden, ergibt das wegen des begrenzten Anteils der Importe nur eine ebenso begrenzte Auswirkung auf die Gesamtpreisentwicklung (500 Milliarden maximaler Zolleinnahmen entsprechen 1,71 % des BIP). Vermutlich werden die durch Zölle ausgelösten Preiserhöhungen nicht schlagartig wirksam, sondern verteilen sich über einen Zeitraum von zwei, vielleicht auch drei Jahren. Dann ist man bei Größenordnungen, die leicht zwischen den aus anderen Gründen verursachten Preisbewegungen verschwinden und nicht so ohne weiteres der eigentlichen Ursache zugeordnet werden können. Je mehr das der Fall ist, desto weniger werden steigende Preise eine politische Wirksamkeit entfalten.
Trump hat seine Zölle durchgesetzt. So gesehen hat er mit seiner erpresserischen Vorgehensweise eindeutig einen Erfolg erzielt.
Und es gibt noch einen weiteren Punkt, den er als Erfolg verbuchen kann. Alle Handelspartner, außer China, haben auf energische Gegenmaßnahmen verzichtet. Dadurch wurde ein allgemeiner Handelskrieg erst einmal vermieden. Ein außer Kontrolle geratener Handelskrieg hätte tiefgreifende Auswirkungen haben können, weltweit und natürlich auch auf die USA. Das war ein nicht ungefährliches Risiko. Diese Klippe konnte (vorläufig) umschifft werden.
Allerdings ist der Erfolg in erster Linie ein kurzfristiger und politischer, kein wirtschaftlicher. Trump konnte sich wieder einmal als durchsetzungsstarker Präsident präsentieren. Welche langfristigen ökonomischen (und sonstigen) Folgen dieser Kurs haben wird, steht auf einen anderen Blatt. Die Mehrzahl der durch die Zölle ausgelösten Effekte werden sich erst mit einer etwas größeren zeitlichen Verzögerung zeigen. Erfolg oder Scheitern der Trump'schen Politik wird man letztlich erst nach einigen Jahren wirklich beurteilen können.
In welchem Ausmaß sich die propagierte Reindustrialisierung einstellen wird, muss sich zukünftig zeigen. Es gibt einige Gründe, um diesbezüglich skeptisch zu sein (siehe „Zölle und ihre Wirkungen“). Sicher wird es einige Firmen geben, die in den USA Produktionsstätten aufbauen bzw. dort bereits vorhandene erweitern. Auch schon vor Trump und seinen Zöllen haben ausländische Firmen ausreichend Gründe gesehen, um in den USA zu produzieren. Das ist nichts Neues und das wird auch in Zukunft geschehen, die Frage ist nur, in welchem Ausmaß.
Die Abkehr von der Freihandelspolitik wird die Globalisierung mit Bezug auf die USA erheblich ausbremsen. Es ist aber kaum vorstellbar, dass die bereits erfolgte Globalisierung wieder substanziell rückgängig gemacht wird. Eine massive Rückverlagerung etwa bei Mode und Bekleidung ist eigentlich nur denkbar, wenn durch entsprechende Innovationen eine weitgehend automatisierte Herstellung möglich wäre. Aber das wäre dann auch nicht mehr mit vielen neuen Arbeitsplätzen verbunden. Bei etlichen anderen Produkten und Industriezweigen ist die Lage prinzipiell ähnlich.
Wenn es den USA darum geht, ihre hegemoniale Stellung auf industriellem Gebiet zu erhalten bzw. wiederzugewinnen, sind sowieso andere Branchen entscheidend.
Trump hat auf ökonomischem Gebiet erklärtermaßen im wesentlichen drei Ziele: einmal neue Quellen für Staatseinnahmen zu erschließen, zweitens viele industrielle Arbeitsplätze zu schaffen und drittens die hegemoniale Position in der Weltwirtschaft genauso wie die internationale Konkurrenzfähigkeit der USA zu erhalten. Für alle drei Ziele gibt es aus seiner Sicht dringende und starke Gründe. Trump verspricht - ob er selbst daran glaubt, ist schwer zu sagen - mit Zöllen alle drei Ziele erreichen zu können. Aber mit Zöllen ist das grundsätzlich nicht möglich. Ziel eins und zwei lassen sich zwar prinzipiell mit Zöllen anstreben, wenn auch nicht problemlos und nicht ohne Einschränkungen. Das dritte Ziel lässt sich aber mit Zöllen gar nicht erreichen. Denn Arbeitsplätze, die wegen hoher Zölle geschaffen oder erhalten werden, sind offensichtlich international nicht konkurrenzfähig, sonst wären sie ja auch ohne Zölle vorhanden. Zum Erhalt und Ausbau der ökonomischen Stärke und der Konkurrenzfähigkeit der USA braucht es andere Mittel. Hohe Zollmaun haben dabei eher einen negativen Effekt. Kurzfristig zeitigen die Zölle wahrscheinlich nur geringe Auswerirkungen auf die Konkurrenzfähigkeit, langfristig könnte das anders sein.
Die wirtschaftliche Entwicklung wird selbstverständlich nicht nur von den aktuellen Maßnahmen Trumps beeinflusst, sondern auch von vielen anderen Faktoren, geplanten wie ungeplanten. Inflationsgefahren z.B. gibt es nicht nur wegen höherer Zölle. Konjunkturen und Rezessionen können auch ganz andere Ursachen haben. Zusammen mit den oft nur als Tendenz sichtbar werdenden Auswirkungen der Zollpolitik eröffnet das für einen Politiker wie Trump viele Möglichkeiten, politisch zu reagieren, durch neue Aktionen abzulenken oder Sündenböcke für auftretende Probleme zu präsentieren.
Resümee
In den letzten Jahrzehnten, unter der Dominanz der neoliberalen Ideologie und Praxis, hat die reale ökonomische Entwicklung auch Resultate hervorgebracht, die aus Sicht der USA einer Korrektur bedürfen. Wie oben beschrieben, sind das die negativen Folgen der Globalisierung, das Handelsbilanzdefizit und ganz besonders der wirtschaftliche Aufstieg Chinas als ein ernst zu nehmender Rivale.
Trump und das Erstarken der MAGA Bewegung können als Reaktion auf diese real existierenden Probleme verstanden werden. Die objektive Lage ist zwar ein Grund, neben anderen Gründen, für das Phänomen Trump und für das Erstarken der MAGA Bewegung. Das bedeutet aber in keiner Weise, dass deren konkrete Politik die genau richtige, notwendige und alternativlose Reaktion auf diese Lage wäre. Sie ist nur eine von vielen denkbaren Reaktionen.
Die objektive Lage handelt nicht selbst, das können selbstverständlich nur Menschen. Diese handeln eingebunden in die gesellschaftlichen Bedingungen und Strukturen, geprägt durch frühere Erfahrungen, beeinflusst durch die Medien usw.. Politische Bewegungen entstehen aus der Konfrontation mit der Realität, sie entwickeln sich aber meist urwüchsig und oft chaotisch, wie Trump und die MAGA Bewegung besonders deutlich zeigen.
Die momentan in den USA vorherrschende politische Richtung, die von Trump und seinen MAGA- Anhängern umgestaltete Republikanische Partei, ist in sich heterogen, widersprüchlich, in eigene Fehleinschätzungen und Ideologien verstrickt und kaum in der Lage, eine in sich logische wirtschaftspolitische Linie zu entwickeln. Ihre konkrete Politik ist geprägt von permanenten Lügen und demagogischen, da substanzlosen, Versprechungen, die die vorhandenen Schwachstellen überdecken sollen. Das „Projekt 2025“ der Heritage Foundation wurde in der Absicht gestartet, für die Bewegung eine systematische Vorgehensweise und Programmatik zu entwickeln. Man kann selbstverständlich nicht sagen, dass das Projekt gescheitert wäre. Aber es war nicht erfolgreich in dem Sinne, dass die Widersprüche aufgelöst werden konnten und eine, zumindest bei ökonomischen Fragen, wirklich kohärente Politik entwickelt worden wäre.
Bei der Zollpolitik wird das deutlich. Mit Zöllen, so wird versprochen, lässt sich alles lösen, kann man alles erreichen. Aber ein Zollregime, das das Handelsbilanzdefizit mindert, die Reindustrialisierung antreibt, dem Staat reichlich Einnahmen beschert, stabile Preise sichert, andere Regierungen ohne Nebenwirkungen diszipliniert und auch sonst nur Vorteile für die USA bringen würde, gibt es nicht. Das Zerwürfnis zwischen Trump und Elon Musk ist z.B. auch eine Folge von solchen bestehenden Widersprüchen.
Die außenwirtschaftliche Verflechtung der USA ist zwar im Vergleich mit anderen Ländern relativ gering, aber auch der US-Kapitalismus ist nicht unabhängig vom Rest der Welt. Das betrifft nicht nur den Handel mit gegenständlichen Waren, sondern auch Dienstleistungen, die Finanzmärkte, den Dollarkurs, die Börsen usw.. Nur solange die (Welt-)Wirtschaft einigermaßen reibungslos funktioniert, beschert sie dem Kapital die erhofften Gewinne. Das kapitalistische System ist aber krisenanfällig und labil, jede Störung kann erheblichen Folgen verursachen.
Wie oben gesagt, Trump ist mit seiner Politik eine Wette eingegangen. Wie diese Wette ausgehen wird, wer wie viel gewinnt oder verliert und ob die hegemoniale Position der USA am Ende seiner regulären Amtszeit (und darüber hinaus) gestärkt oder geschwächt sein wird, ist noch offen.
(Stand 02.09.2025)
Anhang:
Das „Big Beautiful Bill“ (BBB)
Trump war dieses Gesetz ein großes Anliegen, weil damit eine Reihe von Versprechungen aus dem Wahlkampf umgesetzt wurden. Eigentlich handelt es sich um ein Haushaltsgesetz, in das aber immer mehr hineingepackt wurde und das dadurch auf etwa 900 Seiten angewachsen ist. Es enthält Bestimmungen zu ganz verschiedenen Bereichen.
Die Verabschiedung durch Repräsentantenhaus und Senat war zeitweise unsicher, weil es bei den Republikanern Kritik und Ablehnung von einzelnen Abgeordneten gab, die Demokraten lehnten es geschlossen ab. Die Mehrheit der Republikaner in den beiden Parlamentskammern ist bekanntlich dünn, es müssen nicht viele ihre Zustimmung verweigern, um ein Gesetz scheitern zu lassen. Letztlich wurde es aber nach einigem Gefeilsche verabschiedet. Auch deshalb, weil die kritischen Republikaner unterschiedliche Positionen vertraten und sich deshalb gegenseitig neutralisierten. Es gab welche, deren Hauptanliegen ein möglichst kleines Haushaltsdefizit war und die bereit gewesen wären, noch schärfere Kürzungen im Sozialbereich mitzumachen und andere, die eher wegen der Kürzungen Bedenken hatten.
Die wichtigsten Bestimmungen betreffen
die Steuerfragen: In seiner ersten Amtszeit hatte Trump bereits ein Steuersenkungsprogramm bei der Einkommenssteuer umgesetzt. Einige dieser Maßnahmen waren aber zeitlich begrenzt. Diese Begrenzung wurde jetzt aufgehoben, die Steuersenkungen sind nun auf Dauer wirksam. Da es sich um die Weiterführung eines bereits bisher bestehenden Zustands handelt und sich für die Betroffenen konkret nichts ändert, wurden noch etliche weitere Steuergeschenke eingeführt, damit behauptet werden kann, dass vom Gesetz 84% der Steuerzahler profitieren werden. Dazu gehören unter anderem ein höherer Steuerfreibetrag für Rentner und verbesserte Steuerabzüge für Familien pro Kind. Wer ein Auto aus US-Produktion auf Kredit kauft, kann die fälligen Zinsen bis zu einem Höchstbetrag steuerlich anrechnen. Trinkgelder und Zahlungen für Überstunden werden unter bestimmten Bedingungen von der Steuer befreit.
Von der Struktur der Steuermaßnahmen her profitieren wegen der Weiterführung der Einkommensteuersenkungen hauptsächlich die Besserverdienenden und noch mehr die ausgesprochenen Großverdiener. Die Einnahmen des Staates verringern sich damit erheblich. Die anderen Maßnahmen sind breiter gestreut, haben aber ein deutlich geringeres Entlastungsvolumen.
Laut einer Analyse des überparteilichen Tax Policy Center (https://www.taxpolicycenter.org) kann die Gruppe der Bestverdienenden (die obersten 20% mit Einkommen von 270 000 Dollar oder mehr) mit einer durchschnittlichen jährlichen Steuerersparnis von 12 500 Dollar rechnen. Die Gruppe der Kleinverdiener (die untersten 20% mit jährlichen Einkommen von 35 000 Dollar oder weniger) wird nur um 150 Dollar entlastet. 60% des gesamten Volumens der Steuersenkungen gehen an die obersten 20% der Haushalte. Dabei profitieren die relativ wenigen Spitzenverdiener mit Einkommen über 460 000 Dollar mit ca. 30% aller Entlastungen ganz besonders.
den Sozialbereich: Gekürzt wird bei den ärmsten Amerikanern, z.B. bei den Beziehern von staatlichen Lebensmittelmarken, das betrifft circa 42 Millionen Familien. Zu den Verlierern gehören auch die bei der staatlichen Krankenversicherung „Medicaid“ Versicherten. Für sie alle gelten in Zukunft strengere Arbeitsauflagen, mehr Nachweispflichten und es gibt keine automatische Verlängerung der Ansprüche mehr. Medicaid ist der größte Krankenversicherer der USA. Etwa 78 Millionen Bedürftige sind dort versichert, Obdachlose, Menschen mit Behinderungen, Schwangere und sehr viele Kinder. Die neuen Vorschriften sind kompliziert, deren konkrete Auswirkungen lassen sich in vielen Fällen nicht so ohne weiteres abschätzen. Angeblich sollen die neuen Bestimmungen Missbrauch und Betrug verhindern. Das eigentliche Ziel aber dürfte sein, immer mehr Menschen aus den Hilfsprogrammen herauszudrängen. Es gibt Schätzungen, dass bis 2034 etwa 12 Millionen Menschen davon betroffen sein könnten und den Versicherungsschutz verlieren.
Ein deutliches Licht auf die politischen Absichten werfen die Bestimmungen zum Inkrafttreten der Regelungen. Bei den Steuererleichterungen gilt das sofort, bei den Einschnitten im sozialen Bereich wartet man bis nach den Wahlen im November 2026. In den sogenannten Midterm-Wahlen geht es für die Republikaner um ihre knappen Mehrheiten im Kongress.
Das „Big Beautiful Bill“ enthält auch noch viele weiteren Bestimmungen, die hier nicht alle behandelt werden können. Zumindest erwähnt werden sollen die Streichung von Mitteln zur Förderung der erneuerbaren Energien und die Steuererhöhungen auf den Besitz von privaten Universitäten.
Und nicht zu vergessen: die Mittel für das Militär werden selbstverständlich angehoben, eine massive Steigerung erfährt auch das „Department of Homeland Security“ (Ministerium für Heimatschutz), das für den Grenzschutz und die Maßnahmen gegen die Migranten verantwortlich ist.
Obwohl ein ausgeglichener Haushalt eigentlich immer noch das Ziel vieler Republikaner ist, das Staatsdefizit wird durch das BBB in keiner Weise eingedämmt. Ganz im Gegenteil, für die Zukunft ist mit einem weiteren kräftigen Anstieg der Staatsverschuldung zu rechnen. Das „Congressial Budget Office“ (Haushaltsbüro des Kongresses, CBO) hat für die nächsten zehn Jahre, veranlasst allein aufgrund des BBB, einen Anstieg um 3,5 Billionen Dollar prognostiziert. Für die Gesamtverschuldung erwartet die Projektion der CBO über den Zeitraum der nächsten zehn Jahre einen Anstieg um ca. 24 Billionen. Trump hat hier andere Prioritäten als manche Republikaner (oder auch Elon Musk) und er hat sich durchgesetzt.
Zölle und ihre Wirkungen
Trump spricht sehr viel von Zöllen. Zollpolitik ist für ihn offensichtlich das zentrale Mittel, um nicht zu sagen das Wundermittel, um seine Ziele zu erreichen. Auch eindeutig politische Ziele sollen mit der Androhung von Zöllen durchgesetzt werden.
Aber Zölle sind ein zweischneidiges Schwert. Neben den gewünschten, angestrebten Wirkungen haben sie (fast) immer auch nicht gewünschte, negative Wirkungen.
Im wesentlichen gibt es drei Ziele, die durch Zölle angestrebt und erreicht werden können. Das erste Ziel ist, Einnahmen für den Staat zu generieren. Dabei stellt sich die Frage, wer letztlich diese zusätzlichen Staatseinnahmen aufbringen muss. Die Trump'sche Rhetorik vermittelt den Eindruck, das wäre das Ausland, das Ausland müsste die Zölle zahlen. Unbestreitbar können Zölle anderen Ländern schaden, denn sie behindern deren Exporte. Aber zahlen sie deswegen die geforderten Zölle? Das ist keineswegs generell der Fall. Zölle müssen beim Import auf den sogenannten Zollwert der Waren, der selbstverständlich niedriger als der Verkaufspreis ist, gezahlt werden. Unmittelbar zahlen muss das der Importeur, Zölle fallen deswegen grundsätzlich im Inland an und sie sind immer und ohne Ausnahme zusätzliche Kosten. Es gibt viele empirische Daten, die zeigen, dass höhere Zölle sehr oft über höhere Preise an die Endabnehmer weitergegeben werden. Prinzipiell ist es möglich, dass die jeweiligen Exporteure (also das Ausland) durch Preissenkungen die preistreibende Wirkung von Zöllen abmildern oder gar ausgleichen. Sie würden damit auf Profite verzichten, unter Umständen sogar Verluste in Kauf nehmen. Das geschieht auch durchaus in der Realität, z.B. um einen wichtigen Absatzmarkt zu verteidigen. Klar ist aber auch, einen solchen Kampf um den Absatzmarkt kann es nur für eine begrenzte Zeit geben. Er findet spätestens dann sein Ende, wenn die schwächsten Anbieter aufgeben.
Das zweite Ziel ist der Schutz der heimischen Produktion. Es ist offensichtlich, dass dieses Ziel in Konkurrenz zum ersten Ziel steht. Denn kommt es infolge von Zöllen zu einer Steigerung der heimischen Produktion, werden für diese dann im Inland produzierten Waren keine Zölle mehr fällig. Je erfolgreicher die Produktionsverlagerung, desto geringer fallen die Zolleinnahmen aus.
Außerdem kann eine durch Zölle geschützte Produktion, die ohne diese Zollmauern nicht konkurrenzfähig wäre, für die Endabnehmer teuer werden. Auch zu diesem Effekt gibt es viele Beispiele aus der Praxis.
Jede Produktionsverlagerung setzt voraus, dass dafür ausreichende Kapazitäten (z.B. bezüglich Arbeitskräften und deren Qualifikationen oder der benötigten Infrastruktur) vorhanden sind. Das gilt vor allem, wenn es um Produktionsverlagerungen im großen, auch gesamtwirtschaftlich relevanten Umfang geht. Eine detaillierte Analyse der Strategien kapitalistischer Firmen zeigt immer wieder, die Schaffung von neuen Produktionskapazitäten ist von vielen Faktoren abhängig. Die Vermeidung von Zöllen ist einer dieser Faktoren, aber bei weitem nicht der einzige und sehr oft auch nicht der entscheidende. Die empirische Evidenz, dass allein Zölle einen Standort stärken, ist jedenfalls gering.
Das dritte denkbare Ziel ist ein politisches: der Einsatz von Zöllen als Waffe, um einem Land zu schaden bzw. Schaden anzudrohen. Es handelt sich dabei um eine spezielle Art von Wirtschaftssanktion. Wie bei allen anderen Wirtschaftssanktionen ist auch bei dieser Variante die Schädigung des Gegners nicht ohne Schäden für die eigenen Interessen zu haben. Insbesondere wenn die Handelsbeziehungen bedeutend sind und für viele Produkte keine in Qualität und Preis vergleichbare Alternative vorhanden ist, können die Schäden für die eigene Wirtschaft bedeutend sein.
Welche exakten Folgen eine generelle Zollerhöhung nach sich zieht, lässt sich pauschal nicht vorhersagen. Die konkreten Folgen sind von den jeweiligen Konkurrenz- und Marktverhältnissen abhängig und können von Produkt zu Produkt stark differieren. Werden die Zölle für sehr viele Produkte erhöht, ist deshalb mit einem Mix unterschiedlicher Folgen zu rechnen, von Preiserhöhungen in verschiedenen Ausmaßen, über Produktionsverlagerungen bis zum Verschwinden einzelner Produkte vom Markt.
Zölle können lange Ketten von indirekten Wirkungen auslösen, die kaum zu überblicken sind. Das soll am Beispiel der Zölle auf Stahl (und Aluminium) von 50% kurz aufgezeigt werden. Diese Zölle schützen die heimischen Werke vor billiger Konkurrenz aus dem Ausland. Das ist gut für die Stahlindustrie und gut für die dort beschäftigten Arbeiter. Beides dürfte in diesem Fall der beabsichtigte Zweck der Zölle sein. Aber sie betreffen auch alle, die Stahl in irgendeiner Form verwenden. Dazu gehören viele Branchen: Automobil, Baumaschinen, landwirtschaftliche Geräte, die Bauwirtschaft und viele mehr. Deren Kosten steigen im Schnitt, weil die günstigsten Angebote nicht mehr zur Verfügung stehen. Produzieren die Firmen für den heimischen Markt, wie z.B. die Bauwirtschaft, werden sie ihre höheren Kosten beim Preis berücksichtigten, exportieren sie viel, ist es fraglich, ob sie die höheren Kosten für Stahl international weitergeben können. Der Baumaschinen-Hersteller Caterpillar z.B., dessen schwere Maschinen viel Stahl enthalten, hat damit einen Anreiz, Teile der Produktion in seine ausländischen Werke zu verlegen.
Rechtliches: Das Vorgehen Trumps ist rechtlich stark umstritten. Denn eigentlich müssen Zölle vom Kongress beschlossen werden, so sieht es die Verfassung vor. Es gibt aber mehrere (alte) Gesetze, die dem Präsidenten das Recht geben, unter bestimmten Umständen tätig zu werden. Bei seiner bisherigen Zollpolitik hat Trump ausschließlich auf der Basis solcher Gesetzte gehandelt. Die Zölle für Stahl und Aluminium beruhen z.B. auf dem „Trade Expansion Act“ von 1962, der dem Präsidenten erlaubt, Zölle zu verhängen, wenn die nationale Sicherheit in Gefahr ist. Das Gesetz sieht aber nur produkt- bzw. branchenspezifische Zölle vor. Bei den länderspezifischen Zöllen beruft sich Trump auf den „International Emergency Economic Power Act“ von 1977. Allerdings muss dazu das Gesetz sehr frei auslegt werden. Das Gesetz verlangt als Voraussetzung einen Notstand, der laut Regierung durch das Handelsbilanzdefizit gegeben sein soll, und sieht als zu ergreifende Maßnahmen die Regulierung von Importen vor. Das Wort „Zoll“ taucht im Gesetz nicht auf. Dementsprechend wurde das Vorgehen Trumps vor Gericht angefochten. Ende August hat bereits die zweite Instanz entschieden, dass die Länderzölle durch den Kongress genehmigt werden müssten. Die neuen Zölle bleiben aber vorläufig in Kraft, bis die endgültige juristische Klärung durch das oberste Gericht erfolgt ist.