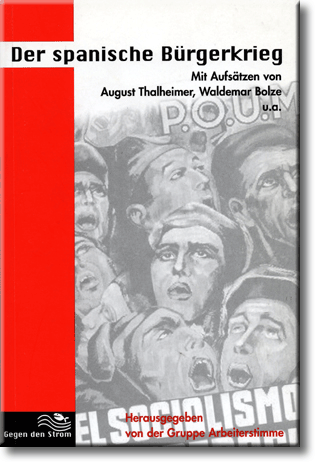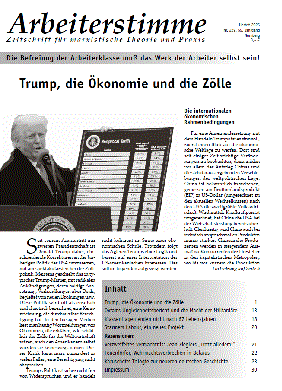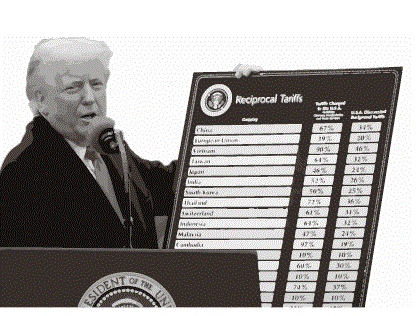Oxfam leistet mit seinem jährlichen Reichtumsbericht anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos einen wichtigen Beitrag dazu, die Ungleichheit der Reichtumsverteilung auf der Welt in das Licht der Öffentlichkeit zu zerren. Der obszöne Reichtum, den Milliardärinnen und Milliardäre jedes Jahr immer schneller anhäufen, bliebe ja sonst ganz im Verborgenen, ganz im Interesse der scheuen Kapital-Rehlein. Auch die Forderungen, die Oxfam stellt, um die Verteilung des Reichtums zu steuern und gerechter zu machen, weisen im Rahmen des bestehenden weltweiten Kapitalismus in die richtige Richtung. Allein, es bleibt die Frage, wie sollen die Forderungen umgesetzt werden, woher soll die Gegenmacht kommen?
Die Arbeiterklasse, die das sein könnte, ist gespalten und hat ihr Klassenbewusstsein verloren, sie ist zurzeit ein Nichts. Die Lebensumstände, verschwundene Solidarität und nicht zuletzt die Macht der Medien, auch der öffentlich-rechtlichen, haben da maßgeblich dazu beigetragen; von den sog. „sozialen“ Medien ganz zu schweigen. Die „sozialen Plattformen“ sind eine wachsende Bedrohung auch für bürgerliche Demokratien, weil sie rechtspopulistische oder extreme Positionen bevorzugen und Wahlen massiv beeinflussen können. In Deutschland hat Musk seine Freunde von der AfD im Wahlkampf unterstützt und ihnen gehörig Schützenhilfe geliefert. Das wird in Zukunft sicherlich zunehmen.
Rechte Parteien finden ihre Anhängerschaft in allen Schichten der Bevölkerung, doch in der Arbeiterschaft stoßen sie auf überdurchschnittlich große Sympathie. Die AfD erhält unter den Gewerkschaftsmitgliedern prozentual mehr Wählerstimmen als in der Gesamtbevölkerung. Und die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder, die AfD gewählt haben, ist auch bei den letzten Bundestagswahlen weiter gewachsen.
Wie die Regierungsbildung in den USA zeigt, gehen die Entwicklungen in eine ganz andere Richtung als von Oxfam angemahnt und für die Weltgesellschaft nötig.
Das Kapital schafft sich den Staat, der ihm die besten Bedingungen zur Profitmaximierung gewährt. Diese Tatsache war vor nicht allzu langer Zeit bis in sozialdemokratische Kreise Allgemeingut. Allerdings hatten sich die Vertreter der Kapitalfraktionen mehr oder weniger dezent im Hintergrund gehalten und die Arbeit ihren Lobbyisten überlassen. Seit Trumps erster Amtszeit änderte sich das grundlegend. Despoten wie Bolsonaro in Brasilien und Milei in Argentinien treten in der Öffentlichkeit unverhohlen mit neoliberalen Programmen auf und werden in die Regierung gewählt; Wähler und Wählerinnen sind von ihrer Lebenssituation und dem Establishment enttäuscht und erhoffen sich Verbesserung. Wie war das nochmal mit dem Bock als Gärtner?
Das Kapital hat sein Klassenbewusstsein nicht verloren. Ein Beispiel ist der Börsenspekulant Warren Buffett, der den Krieg der Reichen gegen die Armen wiederholt benannt hat. Der „New York Times“ sagte er 2006: „Es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt, und wir gewinnen.“
Schlägt die Quantität des Reichtums in eine neue „Qualität“ der politischen Macht um?
Bei Donald Trumps Amtseinführung saßen die reichsten und mächtigsten Männer der USA in der ersten Reihe. Das veranlasste die Monitor-Redaktion zu dem Beitrag: Macht der Tech-Milliardäre: Angriff auf die Demokratie, der am 23.1. gesendet wurde. Hier einige Aussagen aus der Sendung:
„Bei der Amtseinführung von Donald Trump demonstrierten die Chefs der Tech-Giganten X, Meta, Google und TikTok ihre Nähe zum US-Präsidenten.
Musk und Zuckerberg sind zwei der Tech-Milliardäre, die sich früher eher liberal gaben. Zuckerberg sperrte einst sogar Trumps Facebook-Konto. Zu der Riege gehört auch Amazon-Chef Jeff Bezos, seit elf Jahren Eigentümer der „Washington Post“. Jetzt hat die Zeitung den Abdruck einer Karikatur verweigert, die Bezos und andere beim Kniefall vor Trump zeigt.“
Constanze Kurz vom Chaos Computer Club meinte:
„Elon Musk gehört zu Trumps Team. Mit seiner milliardenschweren Plattform X will er sich keinen Regeln mehr unterwerfen. Stattdessen die eigenen Regeln durchsetzen. Mit X macht er Wahlkampf für rechte und rechtsextreme Parteien – in Italien, Großbritannien und in Deutschland. Spätestens jetzt sollten alle Alarmglocken schrillen.“
Claus Leggewie, Politikwissenschaftler an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, führt dazu aus: "Was wir beobachten, ist das Umkippen einer Demokratie in eine Plutokratie. Die Direktherrschaft der Superreichen, die nicht etwa nur Hintenrum ihren Einfluss geltend machen, sondern die tatsächlich direkt nach der Macht greifen."
So hat der US-amerikanische Präsident dem Tech-Milliardär Musk den Auftrag gegeben, die Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst der USA auf Effektivität zu durchforsten. Das Team von Milliardär Musk, mit der Bezeichnung DOGE (Department of Government Efficiency), überprüft eine US-Behörde nach der anderen und treibt massenhafte Entlassungen von Staatsbediensteten voran. Dieser Aufgabe kommt Musk, ohne Rücksicht auf Verluste und ohne sich an arbeitsrechtliche Vorgaben zu halten, nach. In einem besonders delikaten Fall wurden 300 Mitarbeiter der US-Atomsicherheitsbehörde gefeuert. Sie wachen über den Bestand von US-Atomraketen, sind für die Wartung und Sicherung zuständig und beaufsichtigen auch den Bau neuer Nuklearwaffen. Die NNSA ist auch damit befasst, Terroristen und „Schurkenstaaten“ daran zu hindern, sich waffenfähiges Plutonium zu beschaffen. Diese Kündigungen wurden inzwischen wieder zurückgenommen. Aber der Fall zeigt: der Willkür sind Tür und Tor geöffnet, ohne Rücksicht auf geltende Rechte und Gesetze. Auf einer Konferenz der US-Konservativen hat sich Musk für seine radikalen Stellenstreichungen feiern lassen. Unter dem Jubel der Anwesenden schwenkte er eine Kettensäge durch die Luft – ein Geschenk des argentinischen Präsidenten Javier Milei. „Das ist die Kettensäge für die Bürokratie“ zitieren die Nürnberger Nachrichten Musk, der ein enger Berater von Präsident Trump ist.
Ein weiterer Milliardär und Strippenzieher hinter Trump ist Peter Thiel. Er steht politisch weit rechts, hält sich aber im Gegensatz zu Musk eher im Hintergrund. Als ein Gründer von PayPal und Investor hat er sich ein Milliardenvermögen erworben und J.D.Vance im Wahlkampf massiv unterstützt. „Thiel bekennt sich zum Libertarismus – einer politischen Philosophie, die persönliche Freiheit über staatlichen Einfluss stellt –, während er gleichzeitig die Politik des freien Marktes ablehnt, da freier Wettbewerb Profite senke. Er lobt die Praxis, Behörden gegenüber zu lügen, um sich deren Einfluss zu entziehen, da aus seiner Sicht „Firmen über Staaten“ stünden. Unternehmen würden besser geführt als Regierungen, weil an ihrer Spitze ein alleiniger Entscheider mit annähernd diktatorischer Vollmacht steht, der keiner demokratischen Legitimation bedarf. Aus ähnlichen Gründen sieht er das Frauenwahlrecht kritisch. Thiel werden Kontakte zur neoreaktionären Bewegung (NRx) nachgesagt. https://de.wikipedia.org/wiki/Marktwirtschaft
Thiel schwebt eine Herrschaft von Eliten vor, eine oligarchische Diktatur, die nur auf den Eigennutz der Herrschenden ausgerichtet ist und sich vom Gemeinwohl verabschiedet. Freiheit und Demokratie hält Thiel für unvereinbar.
Die Wirtschaftsjournalistin Christine Kerdellant ist der Macht der Superreichen in ihrem Buch „Milliardäre, die mächtiger sind als Staaten“ nachgegangen. Sie kommt zu dem Ergebnis: „Eine Handvoll Männer entscheidet nun über unsere Zukunft. Bill Gates regiert das weltweite Gesundheitswesen. Elon Musk kappt den Internetzugang der ukrainischen Armee, wenn er sie am Handeln hindern will. Mark Zuckerberg schürt den Populismus und gefährdet eine Generation von Teenagern. Jeff Bezos will uns in riesigen Kapseln in Schwerelosigkeit leben lassen. Sergey Brin und Larry Page bereiten die Verschmelzung von Mensch und Maschine vor, um dem Tod ein Ende zu setzen. Und während sie unsere Kinder zu Social-Media-Süchtigen machen, erziehen sie ihre eigenen Sprösslinge fernab von Bildschirmen, um deren geistige Gesundheit zu erhalten.
Die Internet- und KI-Milliardäre haben riesige Vermögen angehäuft, die sie mithilfe von Steuerparadiesen optimiert haben, und sind mächtiger als Staatsoberhäupter geworden. Sie sind niemandem Rechenschaft schuldig und akzeptieren nicht, dass ihren Träumen Grenzen gesetzt werden. Sie entscheiden nun allein über die Zukunft der Welt.“
Die beschriebene Macht der Milliardäre geht einher mit einem Aufschwung der politischen Rechten in den USA und in Europa. Frank Deppe geht dem in einem Aufsatz mit dem Titel „Autoritärer Kapitalismus, Der Aufschwung der politischen Rechten in den Kapitalmetropolen des Westens“ nach. In der Septembernummer der „Zeitschrift für marxistische Erneuerung Z“ des letzten Jahres schreibt er: „In der gegenwärtigen Periode vollzieht sich mit dem Anwachsen der rechtspopulistischen antidemokratischen Kräfte (einschließlich profaschistischer Tendenzen) eine Verschiebung zum autoritären Kapitalismus, der – zu Lasten demokratischer Politikgestaltung – den Primat der äußeren und inneren Sicherheit anerkennt, Disziplin nach Innen durch die Konfrontation mit den äußeren Feinden (Russland und China), durch die ideologische Aufwertung des Nationalismus und der christlichen Religion, vor allem aber durch repressive Maßnahmen gegen Ausländer und Migranten erzwingen will. Das „kriegstüchtige“ Volk muss sich den durch den Staat definierten Zielen der Selbstverteidigung gegen die Feinde von außen und innen unterordnen. …
Damit ein durch Wohlstand und Frieden verwöhntes Volk „kriegstüchtig“ gemacht wird, erfahren die ideologischen Staatsapparate (Medien, Wissenschaftssystem) eine gewaltige Aufwertung.“
Genau das findet gerade statt. Über alle Kanäle wird uns von den Medien eingetrichtert, dass es keine Alternative zu Rüstung und Kriegstüchtigkeit gibt, denn dass Russland die NATO in einigen Jahren angreifen wird, scheint nach Meinung der „Expert*innen“ ausgemachte Sache zu sein. Woher die sogenannten „Sachverständigen“ diese Gewissheit nehmen, sei dahingestellt. Aber es zeigt Wirkung. Nach dem neuesten ZDF-Politbarometer befürworten rund drei Viertel der Deutschen deutlich erhöhte Finanzmittel für die Bundeswehr, auch wenn dies die Verschuldung massiv steigert. Es ist also davon auszugehen, dass uns in Deutschland zumindest verbal kriegerische Zeiten ins Haus stehen.
Hier sei noch auf die Kampagne „Friedensfähig statt Erstschlagfähig“ hingewiesen. Darin haben sich 40 Gruppen der Friedensbewegung zusammengeschlossen. Ihr vorrangiges Ziel ist es zu versuchen, die Stationierung von Mittelstreckenraketen 2026 zu verhindern.
Das Zitat von Frank Deppe bezieht sich aber nur auf einen Teilbereich der kapitalistischen Entwicklung. Eine wesentliche Folge der Verschmelzung staatlicher
Macht des ideellen Gesamtkapitalisten mit den Partikularinteressen einzelner Superreicher ist die Dauerkrise des bürgerlichen Systems und seiner Institutionen.
Deppe spricht deshalb von einer „strukturellen Überforderung des Nationalstaats, die in Zeiten der Polykrise allerdings darin besteht, dass er den Anforderungen des Krisenmanagements nicht gewachsen ist. Er will (bei hoher Staatsverschuldung) im Interesse der Wirtschaft Wachstum, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit fördern, den Umbau zu einem „grünen Kapitalismus“ vorantreiben, die kaputte Infrastruktur (Verkehr, Gesundheit, Bildung) reparieren, die sozialen Sicherungssysteme angesichts der demographischen Entwicklung (Belastung der Rentensysteme) schützen und die steigenden Kosten der Migration, der Armut und der Prekarität übernehmen und – bei Beibehaltung der „Schuldengrenze“ – die Ausgaben für Militär und Rüstung (einschließlich der militärischen Unterstützung der Ukraine und der israelischen Armee) drastisch steigern. … Der Nationalstaat ist als Krisenmanager im Inneren gefordert und ist dabei strukturell überfordert, was sich u.a. in der hohen Staatsverschuldung sowie in der Auseinandersetzung um die sog. „Schuldenbremse“ manifestiert.
Eine funktionierende Infrastruktur entscheidet nicht nur über die Lebensqualität der arbeitenden Bevölkerung, sondern auch über die Qualität des „Standorts“, d.h. über die Verwertungsbedingungen und über die Wettbewerbsfähigkeit des Kapitals“.
So vermag der Einfluss der reichsten Männer und der wenigen Frauen unter ihnen,
ihres Kapitals, ihrer Verbindungen und ihrer verqueren, zutiefst reaktionären Überzeugungen die Funktionsweise bisher gesicherter, „stabiler“ Staatssysteme zu gefährden und damit die Lebensentwürfe von Millionen und Abermillionen Menschen in die Tonne zu treten. Das ist der wahre Skandal dieses Systems, das es zu bekämpfen gilt.