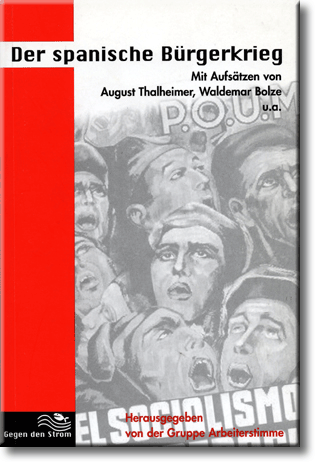Vorbemerkung der Redaktion:
Die folgende Rezension hat innerhalb der Redaktion größere Diskussionen ausgelöst. Die vom Autor vertretene weitgehende Zustimmung zu den Thesen Heiner Karuscheits stieß auf Kritik. Es bestand zwar Konsens darüber, dass die von Karuscheit vorgebrachten Argumente, etwa die starke Stellung des Adels in der Armee, die undemokratischen Verhältnisse in Preußen und die deutsche Neigung zum Obrigkeitsstaat, ihre Berechtigung haben und bei der Einschätzung der Geschichte berücksichtigt werden müssen. Aber, so der Einwand, Karuscheit und damit auch der Rezensent würden dabei zu weitgehende Schlüsse ziehen. Das Kaiserreich von 1871 bis 1918 müsse im Kern als bürgerlicher Staat, wenn auch mit Abweichungen von dessen Idealbild, angesehen werden. Die Junker seien zwar überproportional einflussreich gewesen, aber nicht die herrschende Klasse in diesem Staat und zu dieser Zeit.
Mit diesen kritischen Anmerkungen in Kurzform soll die Diskussion aber keineswegs abgeschlossen werden, ganz im Gegenteil.
Der Zufall wollte es, dass kurz zuvor auch ein Leserbrief von Heiner Karuscheit selbst einging, der ebenfalls im folgenden abgedruckt wird.
Karuscheits Trilogie zur neueren deutschen Geschichte
Teil 1: Die Vorgeschichte des 1. Weltkrieges
Anfang dieses Jahres ist das Buch Der deutsche Rassenstaat. Volksgemeinschaft & Siedlungskrieg: NS-Deutschland 1933-1945. im VSA-Verlag erschienen. Es setzt die Reihe von Untersuchungen zur deutschen Geschichte fort, die Heiner Karuscheit vor über zehn Jahren mit seiner Arbeit Deutschland 1914. Vom Klassenkompromiss zum Krieg. begonnen hat. In der Zwischenzeit hat er Die verlorene Demokratie. Der Krieg und die Republik von Weimar. geschrieben. Diese Analysen bauen aufeinander auf, daher muss man sich entsprechend der historischen Abfolge mit ihnen beschäftigen. Können die Thesen einer Arbeit widerlegt werden, erübrigt sich die Beschäftigung mit den folgenden. Daher startet die Serie mit Deutschland 1914. In Zukunft werden wir in loser Folge seine weiteren Arbeiten vorstellen. (Anmerkung: Dieser Absatz sollte über die gesamte Breite der Seite gesetzt werden.)
Jemand, der im Westen Deutschlands Sozialist werden wollte, konnte die dafür notwendige Bildung nicht in seiner Schule erhalten. Er musste sich andere Lehrer suchen. Hier standen viele Alternativen zur Verfügung. Beim Autor dieser Zeilen reichte das von Bernt Engelmann1, einem linken SPDler, über die Zeitschrift KONKRET und die frühe taz, bis zum Trotzkismus und der DKP.
Die dort anzutreffende Erklärung für den Ersten Weltkrieg findet sich gut zusammengefasst in einem Geschichtsbuch der DDR wieder: “Durch die ungleichmäßige Entwicklung der kapitalistischen Staaten hatten sich seit der Jahrhundertwende die Gegensätze zwischen ihnen verschärft. Die imperialistischen Großmächte drängten auf eine Neuaufteilung der Welt und waren bereit, ihre wirtschaftlichen Interessen mit den Mitteln des Krieges durchzusetzen. Besonders aggressiv war dabei der deutsche Imperialismus. Er wartete auf eine Gelegenheit, seine Eroberungspläne zu verwirklichen.”2
So wie man in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern die Lehrinhalte der Schule akzeptierte, machte man das bei politischen und historischen Fragen, mit Einschränkungen, bei den oben genannten Institutionen. Hinsichtlich des Ersten Weltkrieges gab es keine wirklichen Differenzen. Daher dachte man, dass die ihn auslösenden Faktoren zumindest in der Linken nicht mehr strittig seien. Doch mit der Zeit kamen einem erste Zweifel.
Das hatte mit Beschreibungen des erfolgreichen Wirkens der deutschen Industrie im Europa vor dem Großen Krieg zu tun. Man stellte verblüffende Ähnlichkeiten mit der Art und Weise fest, wie sich diese Industrien nach dem Zweiten Weltkrieg Europa ökonomisch unterworfen haben. Was hätten sie in so einer Lage mit einem Krieg gewinnen können?
Daneben stieß man immer wieder auf Hinweise, dass nicht alle Industriellen bzw. Industriezweige an einer annexionistischen Außenpolitik interessiert waren. Als Beispiel soll ein Zitat von Hugo Stinnes dienen, das vor Jahren Otto Köhler ausgegraben hat.
»Und sehen Sie, was das heißt, wenn ich langsam aber sicher mir die Aktienmehrheit von dem oder jenem Unternehmen erwerbe, wenn ich nach und nach die Kohleversorgung Italiens immer mehr an mich bringe, wenn ich in Schweden oder Spanien wegen der notwendigen Erze unauffällig Fuß fasse, ja mich in der Normandie festsetze – lassen sie noch drei oder vier Jahre ruhigen Frieden sein, und Deutschland ist der unbestrittene wirtschaftliche Herr Europas. … Also drei oder vier Jahre Frieden, und ich, ich sichere die deutsche Vorherrschaft in Europa im Stillen.«3
Das ist in etwa das Konzept, mit dem Deutschland heute die EU dominiert. Da stellt man sich natürlich die Frage, warum wurde dieser Weg abgebrochen und auf Krieg gesetzt?
Auffassungen wie die von Stinnes wurden in Deutschland nur von einer Minderheit vertreten. Das heißt aber nicht, dass sie falsch waren, auch wenn Stinnes sich mit Kriegsbeginn zum Annexionisten wandelte. Dass imperialistische Länder untereinander nicht unbedingt auf Krieg setzen, zeigt das Verhalten von Frankreich und Großbritannien. Sie begannen schon im 19. Jahrhundert nicht mehr direkt aufeinander zu schießen. Der letzte Zusammenstoß zwischen französischen und britischen Truppen fand 1815 in Waterloo statt. Für die Zeit danach wird von “Kolonialspannungen” berichtet. Doch sie ließen diese Gegensätze nie zu einem Waffengang eskalieren. Auch die Ablösung Großbritanniens als führende Weltmacht durch die USA verlief ohne militärische Auseinandersetzungen zwischen ihnen.
Der Blick auf diese Länder stellt die Frage noch eindringlicher in den Raum. Warum ist das aufstrebende Deutsche Reich in diesen Krieg gezogen? Aufgrund seines wirtschaftlichen Erfolges kann es dafür keine ökonomische Erklärung geben.
Eine neue Antwort auf diese Frage gibt Heiner Karuscheit in seiner Arbeit Deutschland 1914. Vom Klassenkompromiss zum Krieg. Dort stellt er die These auf, dass Deutschlands Drang nach einem Waffengang “sich nicht aus der Außenpolitik, sondern aus der inneren Lage des Reichs”4 ergab. Mit der inneren Lage des Reichs meint er nicht die Verwertungsinteressen des Kapitals, sondern das Verhältnis zwischen den Klassen.
Karuscheits Argumente
Die Beweisführung für diese These beginnt mit der gescheiterten Revolution von 1848. Nach der Niederlage der Revolutionäre waren die sie antreibenden Gründe nicht aus der Welt. Weder war man der deutschen Einheit, der Schaffung eines einheitlichen Wirtschaftsgebietes, näher gekommen, noch war Preußen demokratisch.
Die Reichsgründung von 1871 basierte auf einem “Klassenkompromiss zwischen der preußischen Krone und dem Militäradel auf der einen, dem Bürgertum auf der anderen Seite”.5 Dabei realisierte Bismarck die nationalen Träume der Bürgerlichen, während diese auf die Demokratisierung des Landes verzichteten.
Mit diesem Kompromiss wurde die führende Rolle des Adel in der Gesellschaft nicht angetastet. Das zeigt die Sonderrolle des Staates Preußen im Deutschen Reich. Durch das preußische Dreiklassenwahlrecht war sicher gestellt, dass hier immer die Konservativen und ihre Verbündeten die Mehrheit stellten. Dazu gesellte sich die außerparlamentarische Stellung der Armee. Sie befand sich in der Hand des Adels. Damit konnte gegen diese Klasse keine Politik gemacht werden. Frei nach dem Diktum des NSDAP-Mitglieds Carl Schmitt, “Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet”, war der Militäradel gewissermaßen der Souverän des Deutschen Reiches. Deshalb handelte es sich bei diesem Staat auch nicht um einen bürgerlichen Staat.
Dieser Kompromiss war von bürgerlicher Seite nur als zeitweiliges Zugeständnis gedacht. Doch das Entstehen der Arbeiterbewegung verliehen ihm Dauer. Er verwandelte sich von einer undemokratischen Last in eine Versicherung gegen die Revolution.
Das änderte sich mit der Zeit. Die Arbeiterbewegung wurde in einem langen Prozess in den preußisch-deutschen Staat integriert. Das bezeichnet Karuscheit in Deutschland 1914 noch als Verbürgerlichung, in einer Fußnote in Der deutsche Rassenstaat korrigiert er sich. Die weitergehende Beschäftigung mit dem Thema hat ihn zu der Auffassung geführt, “dass die Anpassung an den Staat, dem Charakter des Kaiserreichs entsprechend, nicht die Verbürgerlichung, sondern die Verpreußung der SPD zur Folge hatte.”6 Durch die Verpreußung der Arbeiterbewegung gewann das Bürgertum Handlungsfreiheit.
Das entfaltete nach 1909 seine Wirkung. In diesem Jahr zwang die finanzielle Situation des Staates den Reichskanzler zu einer Steuerreform. Da ihre Notwendigkeit eine Folge des Schlachtflottenbaus war, wurde sie von allen liberalen Strömungen getragen. Doch das Gesetz enthielt auch eine geringfügige Besteuerung der Landgüter. Das lehnten die Konservativen rigoros ab. Der Vorschlag scheiterte und damit “brach das ganze System der Sammlungspolitik auseinander, das Bismarck zur Stabilisierung der alten Ordnung etabliert hatte, und anschließend barsten wie in einer Kettenreaktion die Stützpfeiler dieser Ordnung einer nach dem anderen, bis am Ende der Gesellschaftsvertrag, der das Reich jahrzehntelang zusammengehalten hatte, in Trümmern lag.”7
Nachdem sich die gesellschaftlichen Kräfte neu sortiert hatten, stand “die alte Ordnung und mit ihr der Militäradel vor dem Aus. Das Nächstliegende, um dem Untergang zu begegnen, wäre ein Staatsstreich gewesen.”8 Das wurde auch versucht, scheiterte aber “weil weder (der Reichskanzler, E.B.) Bethmann Hollweg noch Wilhelm II. dafür zu gewinnen waren.”9
“Wenn aber ein Staatsstreich nicht möglich war, blieb nur der Umweg über einen Krieg. Ein neuer Krieg würde demonstrieren, dass nicht das Parlament, sondern das Heer Deutschlands Stärke garantierte, und dass es der Militäradel war, der für den Erfolg verantwortlich zeichnete. Nach dem erwarteten Sieg konnte man sowohl das Wahlrecht als auch die Rechte des Parlaments beschneiden, um so die alten Autoritäten und Machtverhältnisse auf unabsehbare Zeit neu zu befestigen.”10
So ist es gekommen. Der Krieg schuf die Bedingungen für die Errichtung einer Militärdiktatur “und selbst dann wurden Regierung und Kaiser formal im Amt gelassen, um die Fassade aufrechtzuerhalten”.11 Daher ist für Karuscheit der Erste Weltkrieg ein Krieg zur Aufrechterhaltung der alten Ordnung. Er lässt sich nicht mit Lenins Imperialismustheorie erklären, die die Basis des Zitats aus der DDR bildet. Mit Lenins Ausführungen hat sich Karuscheit in einem späteren Aufsatz separat beschäftigt.12
Diese Erkenntnisse sind starker Tobak für alle Sozialisten und Kommunisten, die einmal gelernt haben, dass der Grund für den Ersten Weltkrieg im Expansionsstreben des Kapitals liegt. Starker Tobak auch deshalb, weil damit die Basis einer ganzen Reihe von weiteren linken Auffassungen in sich zusammenfällt.
Karuscheits Thesen im Vergleich
Die neueren Bücher zum Ersten Weltkrieg sind meist, wie auch das seine, im Umfeld des 100. Jahrestages seines Anfangs erschienen. Das liegt gute zehn Jahre zurück. Am bekanntesten ist das Werk “Die Schlafwandler” von Christopher Clark. Dieses und die ähnlich argumentierender Autoren werden hier ignoriert. Sie sind mehr Propaganda als ernsthafte Beiträge zur Debatte.
In einer tatsächlich aktuellen Veröffentlichung13 von 2023 legt der Historiker Bernhard Sauer nüchtern die historischen Fakten auf den Tisch. Doch die Frage, warum die herrschende Klasse Preußens den Krieg wollte, stellt er nicht. Das ist seltsam. Er sollte von Karuscheit gehört haben. Beiträge von beiden finden sich in einem Buch des VSA-Verlags zur Novemberrevolution.14 Sauer referiert in seinem Buch das Septemberprogramm, in dem die Kriegsziele des Reichs festgehalten wurden. Wie er schreibt, wurde mit der Arbeit an diesem Text aber erst nach Kriegsbeginn begonnen.15
Damit bestätigt er Karuscheits Aussage, dass Deutschland als Staat ohne Kriegsziele in den Kampf gezogen ist. Ein Fakt, der innenpolitische Gründe nahe legt. Doch Sauer weist, richtigerweise, auf die weitreichenden Eroberungsforderungen des Alldeutschen Verbandes und der Schwerindustrie hin. Diese wurden schon in früheren Jahren erhoben und sollten “auch mit den Mitteln des Krieges verwirklicht werden”.16 Damit schlägt er sich indirekt auf die Seite derer, die den Krieg auf ökonomische Ursachen zurückführen. Die möglichen innenpolitischen Gründe für den Krieg fallen unter den Tisch.
Manchmal hat man bei Auseinandersetzungen über historische Fragen den Eindruck, - nicht nur in Deutschland -, dass hinsichtlich der eigenen Geschichte Scheinkämpfe geführt werden. Die sich streitenden Parteien diskutieren Aspekte, die nicht zur Erklärung eines Ereignisses beitragen. So werden wichtige Fragestellungen verdrängt und damit auch die fortbestehenden Gründe, die die Gesellschaft in eine Katastrophe geführt haben.
In Deutschland geschieht das beim Streit zwischen den “Schlafwandlern” und den “Imperialisten”. Damit geraten die innenpolitischen Verhältnisse aus dem Blick. Dazu gehören auch die vergebenen Möglichkeiten, den Weg in den Krieg zu erschweren. Das kann für heute bedeutsam sein. In weiteren Arbeiten Karuscheits, aber auch anderer Autoren, wird eine SPD sichtbar, die sich öffentlich gegen den Militarismus wandte. Aber durch ihr reales Handeln hat sie ihn mitgetragen. Da fallen einem sofort Parallelen zur Linkspartei ein. Verbal ist man gegen die immensen Aufrüstungsprogramme, aber ihre Vertreter im Bundesrat stimmen der dazu notwendigen Verfassungsänderung zu. Irgendwelche Parteistrafen wurden gegen diese “Genossen” bisher nicht verhängt.
Wie eine tabulose Diskussion zum Ersten Weltkrieg aussieht, zeigt eine Schrift aus der Schweiz. Darin hat der Historiker Ignaz Miller einen unbefangenen Blick auf die Zustände im Kaiserreich geworfen.
Er macht hinter Deutschlands Kriegsentscheidung drei Faktoren aus, “Überrüstung, Überschuldung und Übermut”17. Polemisch kann man Millers Position so zusammenfassen, dass Deutschland mit dem Krieg Frankreich zu einer Kriegsentschädigung zwingen wollte, um damit die enorme Staatsverschuldung abzubauen. Das ist ein monetärer Grund, dem ein innenpolitisches Motiv zu Grunde liegt.
Zur Begründung des “Übermuts” führt er einen ganzen Strauß an Gründen an, die zu einer “spezifischen Mentalität”18 Deutschlands gehören. Darunter die mangelnde Fähigkeit, Kräfteverhältnisse realistisch einschätzen zu können. Miller hält das für ein historisches Problem, da “der europäische Fortschritt unverkennbar”19 sei. Trotzdem kommt er immer wieder auch auf die Gegenwart zu sprechen, wo er im deutschen Verhalten während der Eurokrise Restbestände dieses Denkens findet.
Unterschiedliche Erklärungsansätze gibt es bei ihm nicht. Er zitiert einfach alle Quellen. Darunter auch diese: “Die im Reichstag von den Konservativen repräsentierten Junker wollen um jeden Preis eine Erbschaftssteuer vermeiden. Wenn der Friede anhält, ist sie unvermeidlich. Der Reichstag hat sie in seiner letzten Sitzung der abgelaufenen Session grundsätzlich beschlossen. Sie ist ein schwerer Schlag für die Interessen und Privilegien des grundbesitzenden Adels. Auf der anderen Seite bildet dieser Adel eine militärische Aristokratie. Es ist aufschlussreich, die Rangliste der [königlich preussischen] Armee mit dem Gotha zu vergleichen. Einzig ein Krieg kann sein Prestige wahren und seinen Familieninteressen dienen […]. Das Grossbürgertum […] hat nicht dieselben Gründe wie die Junker, einen Krieg zu wollen. Bis auf einige Ausnahmen ist es jedoch kriegsgestimmt. Aus Gründen der sozialen Ordnung […]. Die Waffen- und Rüstungsfabrikanten, die Grosskaufleute, die grössere Märkte verlangen, die Bankiers, die auf ein goldenes Zeitalter spekulieren und eine nächste Kriegsentschädigung, denken schliesslich, dass der Krieg ein gutes Geschäft sei.”20
Unwillkürlich vermutet man hier Karuscheit als Autor. Doch das Zitat stammt aus einem Bericht an den damaligen französischen Außenminister, Stéphen Pichon, über die öffentliche Meinung in Deutschland. Er basiert auf den Mitteilungen der Konsulate und Botschaften in den einzelnen Staaten, die das Kaiserreich bildeten. Als Datum wird der 30. Juli 1913 angegeben. Ein Jahr vor Kriegsbeginn! Miller gibt als Quelle ein Livre Jaune an. Das ist eine Edition21 diplomatischer Berichte, mit der man der deutschen Propaganda entgegengetreten ist.
Die Reaktionen auf Karuscheits Thesen
Eine Internetrecherche zu seinem Buch bringt wenige Treffer. Am interessantesten ist die Besprechung des Berliner Historikers Henning Holsten im Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung22. Zur Einordnung dieser Publikation sei vermerkt, dass die entsprechende Ausgabe einen Druckkostenzuschuss von der Rosa-Luxemburg-Stiftung erhalten hat.
Holsten beschäftigt sich eingehend mit Deutschland 1914 und ordnet die Untersuchung in die Debatten zum 100. Jahrestags des Kriegsbeginns ein. “Entgegen dem Bild „schlafwandelnder“ Diplomaten, die blind und ahnungslos in die Katastrophe stolperten, beharrt der Publizist Heiner Karuscheit in seinem … Buch auf den grundlegenden Erkenntnissen der Fischer-Schule, die sich in den 1970er-Jahren sozialgeschichtlich erweitert zum Paradigma vom „deutschen Sonderweg“ verdichteten und seither die historiografischen Debatten um die Modernität bzw. Rückständigkeit des wilhelminischen Kaiserreiches bestimmen. Ausgehend vom „Primat der Innenpolitik“ (Eckart Kehr) sucht er die Ursachen des Krieges nicht in der Konkurrenz der Großmächte, sondern in den Klassenkonflikten innerhalb des Deutschen Reiches. Dabei löst sich K., langjähriger Mitherausgeber der kommunistischen „Aufsätze zur Diskussion“, weitgehend von den marxistisch-leninistischen Dogmen seiner früheren politischen Publizistik.”
Nach einer Beschreibung des Inhalts stellt Holsten die Frage: “War es auf der anderen Seite wirklich nur eine kleine „preußische Herrschaftskaste“, die das Deutsche Reich und ganz Europa aus innenpolitischen Machterhaltungsmotiven in die Katastrophe des Weltkrieges trieb? K. erwähnt selbst, dass es auch innerhalb der progressiven Parteien Kräfte gab, die sich vom Krieg eine klassenpolitische Machtverschiebung zu ihren Gunsten versprachen. Militarismus, nationales Prestigedenken und ein sozialdarwinistisches Politikverständnis waren in der wilhelminischen Öffentlichkeit weit über konservative Kreise hinaus verbreitet – und hatten ihre Entsprechungen in fast allen europäischen Ländern. Medien- und kulturgeschichtliche Dynamiken, wie sie seit bald 20 Jahren die „Neue Politikgeschichte“ in den Fokus nimmt, fehlen bei K. jedoch vollständig. So kommt er in seiner pointierten Zusammenfassung der Sonderwegsthese im Grunde auch nicht über die Erkenntnisse von Fritz Fischer, Hans-Ulrich Wehler und Dieter Groh hinaus. Als linke Gegenposition zum aktuellen diplomatiegeschichtlichen Revisionismus, der die Forschungsergebnisse der alten „Kehr-Schule“ oft nicht widerlegt, sondern einfach nur ignoriert, hat die Studie deshalb durchaus ihren Wert. Doch neues Licht auf den deutschen „Sprung ins Dunkle“ (Bethmann Hollweg) im Juli 1914 wirft sie nicht.”
Eckart Kehr war ein deutscher Historiker. Er promovierte 1927 mit einer Arbeit über Schlachtflottenbau und Parteipolitik 1894–1901. Dort vertrat er die Position, dass die Außenpolitik der damaligen Zeit hauptsächlich durch die Gegensätze zwischen Junkertum und Bourgeoisie im Inland beeinflusst worden sind. Kehr gilt als von Max Weber und Karl Marx beeinflusst, gehörte aber nicht zum kommunistischen Milieu der Weimarer Republik. Trotzdem meinte der Historiker Gerhard Ritter 1931: “Dieser Herr sollte sich, scheint es mir, lieber gleich in Rußland als in Königsberg habilitieren. Denn da gehört er natürlich hin: einer der für unsere Historie ganz gefährlichen ‚Edelbolschewisten‘.”23
Holsten ordnet Karuscheit in eine Traditionslinie der deutschen Geschichtswissenschaft ein. Diese war einem bis heute unbekannt. Warum? Haben die Vertreter der in Deutschland dominierenden Thesen den öffentlichen Raum derart besetzt, dass daneben kein Platz für die “Kehr-Schule” geblieben ist? Oder war man selber so stark im ökonomistischen Denken gefangen, dass man die Hinweise darauf nicht wahrgenommen hat? Aus Sicht der Geschichtswissenschaft mag Holsten recht haben, dass Karuscheits Studie kein “neues Licht auf den deutschen Sprung ins Dunkle” wirft. Für die sozialistisch-kommunistische Bewegung trifft das aber nicht zu.
Das zeigt eine Kurzrezension in der Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung. Darin schreibt der inzwischen verstorbene Historiker Reiner Zilkenat: Der Autor “… gelangt schließlich zu der Anschauung, dass der Steuerkonflikt zwischen den im „Bülowblock“ agierenden Nationalliberalen, Linksliberalen und Konservativen im Jahre 1909 einen irreparablen Bruch des Bündnisses zwischen Adel und Bourgeoisie bedeutete. Neues hat Karuscheit bei alledem kaum zu bieten; seine Darstellung ist aber eine außerordentlich nützliche und detailreiche Zusammenfassung dessen, was zu dieser Thematik in Handbüchern und Standardwerken nachlesbar ist.”24
Zilkenat teilt also Karuscheits Darstellung der Entwicklung bis zum Jahr 1909. Doch für die Zeit danach wirft er ihm vor: “Im Gegensatz zu dieser aus durchsichtigen Motiven verbreiteten Auffassung (Man ist in den Krieg hineingeschlittert. EB) hatte die Kriegspartei in Berlin, … , seit Jahren zielgerichtet darauf hingearbeitet, die erste sich bietende Chance zu nutzen, um die außenpolitischen Ziele – im Minimum ein von Deutschland dominiertes „Mitteleuropa“ und ein groß dimensioniertes Kolonialreich in Afrika – mit kriegerischen Mitteln zu realisieren. Dabei schreckte man vor einem Präventivkrieg nicht zurück. Der Autor kennt offenbar nicht die einschlägigen Quellen oder blendet sie aus, weil sie seinen Thesen widersprechen.” Das überrascht, weist Karuscheit doch auf diese Papiere hin.25 Der Unterschied zwischen den beiden liegt nicht in den genutzten Quellen, sondern in deren Interpretation. Auf die Argumente Karuscheits geht Zilkenat aber nicht ein.
Nicht alle mit der DDR verbundenen Historiker verweigern sich neuen Erkenntnissen. So hat der aus einer antifaschistischen Familie stammende Werner Röhr Karuscheit zwar nicht rezensiert, aber seine Interpretation der Fakten weitgehend übernommen. Das hat er im seinem Buch Hundert Jahre deutsche Kriegsschulddebatte.26 versteckt. Bei den Recherchen zu diesem Text ist man im Archiv der jungen Welt27 zufällig darüber gestolpert. Sie hat das maßgebliche Kapitel als Vorabdruck veröffentlicht.
Resümee
Es findet sich kein Historiker, der Widerspruch gegen Karuscheits Untersuchung angemeldet hat. Dagegen werden viele Quellen beigebracht, die seine Sicht untermauern. Überraschend ist Karuscheits Zuordnung zu einer in der Weimarer Republik entstandenen geschichtswissenschaftlichen Strömung. Verblüfft ist man auch über den Text aus Frankreich. Schaut wirklich kein bundesdeutscher Historiker über den Rhein? Oder machen sie es doch und behalten ihre Erkenntnisse für sich, um nicht negativ aufzufallen?
Es ist sicher richtig, dass Karuscheit keine neuen Fakten vorzuweisen hat. Er ist aber wohl der erste, der aufzeigt, wie die Veränderungen innerhalb und zwischen den Klassen das Deutschen Reich in den Krieg geführt haben. Seine Untersuchung scheint die erste Klassenanalyse im deutschsprachigen Raum zum Ersten Weltkrieg zu sein. Man kann sie nur uneingeschränkt zum Lesen empfehlen.
Emil Berger
1 Deutscher Schriftsteller und Journalist, am Ende der NS-Diktatur Mitarbeit im Widerstand und aufgrund dessen im KZ inhaftiert. Nach dem Krieg Mitglied der SPD.
2 Geschichte. Lehrbuch für Klasse 8. Berlin 1975, S. 178
3 junge Welt, 10.04.2014, S. 10; Kaiser von Deutschland. Wozu brauche ich Krieg, dachte Hugo Stinnes 1911, die Welt liegt mir zu Füßen. Doch drei Jahre später ließ er sich vom Nutzen des großen Mordens überzeugen.
4 Karuscheit, Heiner; Deutschland 1914. Vom Klassenkompromiss zum Krieg. Hamburg 2014, S.243
5 Ebd. S.37
6 Karuscheit, Heiner; Der deutsche Rassenstaat. Volksgemeinschaft & Siedlungskrieg: NS-Deutschland 1933-1945. Hamburg 2025, S. 23
7 Karuscheit 2014, S. 182
8 Ebd. S.210
9 Ebd.
10 Ebd. S.211
11 Ebd. S.210
12 “Kriegsfragen. Warum der Erste Weltkrieg nicht mit Lenins Imperialismustheorie zu erklären ist” in: H. Karuscheit, J. Wegner, K. Werneke, J. Wollenberg; “Macht und Krieg. Hegemoniekonstellationen und Erster Weltkrieg”, Hamburg 2015
13 Sauer, Bernhard; Der Erste Weltkrieg - ein Verteidigungskrieg? Berlin 2023
14 Karuscheit, Heiner; Sauer, Bernhard; Wernecke, Klaus; Vom »Kriegssozialismus« zur Novemberrevolution. Hamburg 2018
15 Sauer 2023, S. 37
16 Ebd.
17 Miller, Ignaz; Mit vollem Risiko in den Krieg. S. 12, Zürich 2014
18 Ebd. S. 13
19 Ebd. S. 161
20 Ebd. S.71
21Les pourparlers diplomatiques (17 mars 1913-4 septembre 1914) X Le livre jaune français. Paris/Nancy 1915
23 Zitiert nach Hans-Ulrich Wehler: Eckart Kehr. In: ders. (Hrsg.): Deutsche Historiker. Bd. 1. Göttingen 1971, S. 100
24 https://www.zeitschrift-marxistische-erneuerung.de/de/article/1250.marx-und-die-neuen-themen.html
25 Karuscheit 2014, S. 211 und 212
26 Röhr, Werner; “Hundert Jahre deutsche Kriegsschulddebatte. Vom Weißbuch 1914 zum heutigen Geschichtsrevisionismus.” Hamburg 2015
27 junge Welt vom 16.06.2015, S. 12, “Brüchiger Machtblock”