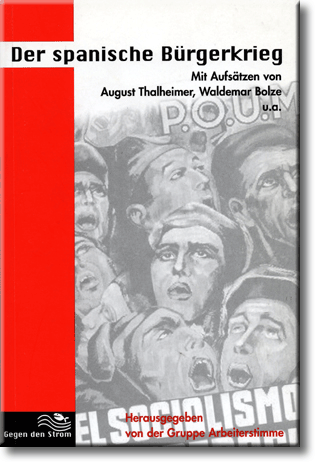Leserbrief zur linksradikalen Politik der KPD
In der Ausgabe der Arsti Nr.226 vom Winter 2024 „Das Verhängnis einer ultralinken Politik unter vorrevolutionären Bedingungen am Beispiel der KPD 1919-1933“ hat Harald Jentsch sich kenntnisreich mit der linksradikalen Politik der KPD auseinandergesetzt. Der Kritik kann man im Wesentlichen nur zustimmen, doch meine ich, dass sie noch einen Schritt weiter gehen müsste. Warum?
Die zentrale Frage zur Bewertung der KPD-Politik lautet nach meinem Dafürhalten, ob die Revolution, die nach dem Weltkrieg auf die Tagesordnung trat, dem Wesen nach eine proletarisch-sozialistische oder eine bürgerlich-demokratische Revolution war. Für die Spartakusgruppe und die aus ihr hervorgehende KPD war dies keine Frage, sie kämpfte als nächstes Ziel für eine sozialistische Revolution. Das von Rosa Luxemburg verfasste „Oktoberprogramm“ der Spartakus-Gruppe propagierte als Aufgabe des Tages die Errichtung der Diktatur des Proletariats, ebenso das mit dem „Oktoberprogramm“ weitgehend identische Gründungsprogramm der KPD vom 30. Dezember 1918.
Darin wurde mit Blick auf den Übergang zum Sozialismus u.a. die „Enteignung des Grund und Bodens aller landwirtschaftlichen Groß- und Mittelbetriebe“ zwecks „Bildung sozialistischer landwirtschaftlicher Genossenschaften“ gefordert; nur „bäuerliche Kleinbetriebe“ sollten davon ausgenommen werden. Das heißt, Spartakus/KPD forderten nicht nur die Enteignung des Großgrundbesitzes, sondern der Masse der Bauernschaft. Eine solche Forderung musste das gesamte Kleinbürgertum, d.h. mehr als der Hälfte der Bevölkerung, zum Gegner der revolutionären Arbeiterbewegung machen. Dieses Revolutionsprogramm fand auch im Proletariat selber keine Mehrheit; die Spartakusgruppe war in der Rätebewegung isoliert.
Um die Novemberrevolution zum Erfolg zu führen, wäre das Konzept einer vom Proletariat geführten demokratischen Revolution im Bündnis mit dem Kleinbürgertum notwendig gewesen; erst deren Erfolg konnte den Weg zum Sozialismus frei machen. Es gab in der Vorkriegs-SPD auch immer wieder Diskussionen über das Verhältnis von demokratischem und sozialistischem Kampf sowie die Frage des Kleinbürgertums. Doch keine dieser Debatten wurde zu Ende geführt. Mit dem Revolutionsprogramm Luxemburgs war der revolutionäre Flügel der Arbeiterbewegung jedenfalls zum Scheitern verurteilt.
Daran schließt sich eine weitere Frage an, die in einem Leserbrief nur angerissen werden kann. Gemeinhin gilt die Novemberrevolution als gescheiterte sozialistische Revolution. Aber muss sie nicht richtigerweise als gescheiterte bürgerliche Revolution gewertet werden?
Denn was war ihr Ergebnis anderes als eine nicht lebensfähige Republik, die aus einer von der SPD-Führung im Bündnis mit der preußischen Obersten Heeresleitung organisierten Konterrevolution gegen die Novemberrevolution hervorging (Ebert-Groener-Pakt)?
Es gab keine soziale Umwälzung, denn weder wurde der Großgrundbesitz enteignet noch Großindustrie und die Banken (deren Verstaatlichung einen späteren Übergang zum Sozialismus ermöglicht hätte). Erst recht nicht wurde der preußisch-deutsche Obrigkeitsstaat zerschlagen und neue demokratische Strukturen aufgebaut (was die Rätebewegung in Angriff genommen hatte). Insbesondere behielt der junkerliche Militäradel die Herrschaft über die Streitkräfte, das entscheidende innenpolitische Machtinstrument. Real war die Republik nicht mehr als ein Überwurf ohne eigene Basis über den fortbestehenden gesellschaftlichen und staatlichen Strukturen der alten Ordnung.
Wenn man die Novemberrevolution aber als gescheiterte bürgerliche Revolution begreift – liegt hier nicht ein Schlüssel für den Aufstieg des Nationalsozialismus, der sich als Gegenbewegung nicht nur gegen „1917“ verstand, sondern auch gegen „1789“, d.h. gegen die zivilisatorischen Errungenschaften der bürgerlichen Revolution?
Gegenwärtig wird erneut der „Kampf gegen rechts“ gefordert, bis hin zur Warnung vor einem neuen Faschismus. Um derartige Forderungen richtig einzuordnen, würde es sich m.E. lohnen, wenn die Kommunisten die Fragen, die am Anfang ihrer Bewegung nach dem Ersten Weltkrieg aufgeworfen wurden, noch einmal reflektieren würden, auch wenn das heißt, scheinbar sichere alte Gewissheiten auf den Prüfstand zu stellen.
Heiner Karuscheit, Gelsenkirchen, 5.Mai 2025