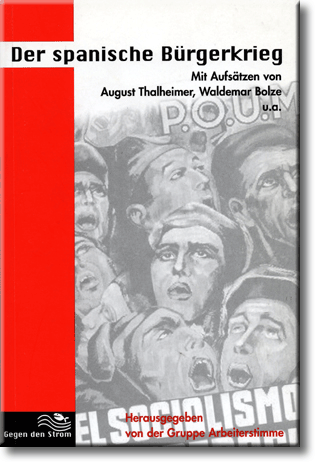Zum Weltwirtschaftsforum in Davos veröffentlicht Oxfam bereits seit Jahren den großen Ungleichheitsbericht, den Bericht über die Verteilung von Reichtum in der Welt. Der aktuelle Bericht „Milliardärsmacht beschränken, Demokratie schützen“ zeigt, wie der Einfluss von Superreichen die soziale Ungleichheit immer weiter verschärft und demokratische Prinzipien in ihren Grundfesten erschüttert. Doch zuerst ein Blick auf die Schattenseite des Reichtums.
(Die Zitate stammen, fall nicht anders gekennzeichnet, aus dem Bericht von Oxfam)
„Reicher Mann und armer Mann
standen da und sah’n sich an.
Und der Arme sagte bleich:
Wär’ ich nicht arm, wärst Du nicht reich.“
(Bertolt Brecht)
Die Kehrseite des Reichtums: Wärn wir nicht arm …
Die Zahl der Menschen, die unter der erweiterten Armutsgrenze der Weltbank von 6,85 US-Dollar leben, ist seit 1990 unverändert bei fast 3,6 Milliarden geblieben. Das entspricht aktuell 44 Prozent der Menschheit. Frauen sind besonders von Armut betroffen. Weltweit müssen 733 Millionen Menschen infolge von Armut hungern – etwa 152 Millionen mehr als 2019.
Viele Länder stehen vor dem Bankrott, sind durch Schulden gelähmt und haben nicht die finanziellen Mittel, um Armut und Ungleichheit zu reduzieren. Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen geben im Durchschnitt 48 Prozent ihres Haushalts für die Rückzahlung von Schulden aus. Das ist weit mehr, als sie für Bildung und Gesundheit zusammen aufwenden. Die Situation ist für diese Länder besonders schwierig, aber auch darüber hinaus zeichnet sich ein besorgniserregendes Bild ab, wie Oxfam in seinem jüngst veröffentlichten Commitment to Reducing Inequality Index, einer Ungleichheitsanalyse von 164 Ländern, zeigt: Vier von fünf Ländern weltweit haben in den letzten von Krisen geprägten Jahren den Anteil im Staatshaushalt für Bildung, Gesundheit und soziale Sicherung gekürzt; vier von fünf haben Rückschritte bei der Steuerprogression und neun von zehn bei Arbeitsrechten und Mindestlöhnen gemacht. Insgesamt sind neun von zehn Ländern in einem oder mehreren dieser drei Bereiche zurückgefallen. Ohne sofortige politische Maßnahmen zur Umkehrung dieses Trends wird daher die Ungleichheit in 90 Prozent der untersuchten Länder mit großer Sicherheit weiter zunehmen. Der ohnehin schon immense Druck auf die politische Stabilität würde damit noch größer – und damit auch die Gefahr für die Demokratie.
Die andere Seite: … wärt ihr nicht reich
Oxfam wurde schon des Öfteren in konservativ-bürgerlichen Medien unterstellt, dass ihre Beschäftigung mit den Reichen zunehmend obsessive Züge angenommen habe. In wessen Händen die Medien wohl sein mögen?
Weltweit ist im Jahr 2024 das Gesamtvermögen der Milliardär*innen um zwei Billionen US-Dollar gestiegen. Ihr Vermögen wuchs damit 2024 dreimal schneller als 2023. Das Vermögen eines*einer Milliardär*in vergrößerte sich im Durchschnitt um zwei Millionen US-Dollar pro Tag. Bei den reichsten zehn Milliardären waren es sogar 100 Millionen US-Dollar pro Tag. Selbst wenn diese zehn Milliardäre über Nacht 99 Prozent ihres Vermögens verlieren würden, blieben sie Milliardäre. Im Jahr 2024 kamen insgesamt 204 neue Milliardär*innen hinzu. Dies entspricht durchschnittlich fast vier neuen Milliardär*innen pro Woche. Damit stieg die Zahl der Milliardär*innen gemäß Forbes-Reichenliste auf 2.769.
Die genauen Zahlenangaben der Vermögen sind sicherlich nicht ganz für bare Münze zu nehmen, sie drücken jedoch eine eindeutige Tendenz aus.
Und in Deutschland?
Auch in Deutschland hat die Ungleichheit in den letzten Jahren stark zugenommen. Während die reichsten 5 Prozent fast die Hälfte (48 Prozent) des gesamten Vermögens besitzen, ging die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung nahezu leer aus. Jedes siebte Kind leidet unter der Armut, und immer mehr Menschen können ihren gewohnten Lebensstandard nicht mehr halten. Gleichzeitig gibt es hierzulande 130 Milliardäre – die viertgrößte Anzahl weltweit. Deren Gesamtvermögen ist nach Berechnungen der Oxfam-Studie allein 2024 um 26,8 Milliarden auf umgerechnet 625 Milliarden US-Dollar angewachsen.
Laut Oxfam ist das Gesamtvermögen der fünf reichsten Deutschen seit 2020 inflationsbereinigt um knapp 75 Prozent gewachsen: von etwa 89 auf rund 155 Milliarden US-Dollar.
Wie viele Millionäre und Milliardäre es in Deutschland gibt, weiß man nicht genau; im oberen Vermögensbereich herrscht weitgehend Intransparenz. Während bei dieser Seite der Medaille am liebsten Stillschweigen bewahrt wird, werden dagegen die Bürgergeldempfänger an den Pranger gestellt; pauschal wird ihnen Missbrauch vorgeworfen. Sie werden für die Schieflage des Staatshaushalts verantwortlich gemacht. Deswegen möchte der neue Kanzler, „natürlich“ ein Multimillionär, das Bürgergeld abschaffen.
Während sich der Reichtum weiter konzentriert, fehlt in den öffentlichen Haushalten das Geld für moderne Schulen, gute Pflege, einen handlungsfähigen Sozialstaat und Zukunftsinvestitionen. Allein der staatliche Investitionsbedarf für eine zukunftsfähige Wirtschaft wird von verschiedenen Wirtschaftsinstituten auf etwa 600 Milliarden Euro veranschlagt.
Statt Reichtum zu besteuern, haben Deutschland und viele andere Staaten Verbrauchsteuern wie beispielsweise die Mehrwertsteuer erhöht, die ärmere Menschen stärker belasten als Reiche. Während die arbeitende Bevölkerung hohe Steuersätze zahlen muss – die weltweit mit zu den höchsten gehören –, werden Vermögende von hohen Steuern und Abgaben verschont.
Eine Studie zum Einfluss von Einkommen auf politische Entscheidungen des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung aus dem Jahr 2016 stellt fest, dass die Wünsche und Bedürfnisse von Menschen mit niedrigem Einkommen mit geringerer Wahrscheinlichkeit politisch beachtet und umgesetzt werden als die Interessen der Bessergestellten. Besonders aktiv hervorzuheben sind dabei Lobbyverbände wie „Die Familienunternehmer“ und die „Stiftung Familienunternehmen und Politik“. Hinter den irreführenden Namen stehen zahlreiche Weltkonzerne und Superreiche. Sie gehören zu den einflussreichsten Lobbyverbänden der Republik. Es geht den Stiftungen vor allem darum, Steuern für Vermögende zu verhindern. Mit Märchen wie dem, dass bei Veränderung der Erbschaftssteuer auch das berühmte Häuschen der Oma betroffen wäre, gelingt es der Stiftung seit Jahren, Veränderungen zu verhindern. So profitieren sie massiv von Steuerprivilegien und beteiligen sich nur in geringem Maße am Solidarsystem der Kranken-, Pflege- oder Rentenversicherung. Vermögende werden immer vermögender, während Steuer- und vor allem Beitragssätze für den Großteil der Menschen wachsen.
In der Folge, so heißt es in der Studie, orientiere sich die Politik „noch stärker an den Interessen der Bessergestellten“. Das führe dazu, dass sich viele Menschen vom politischen System abwenden.
Die Steuerprivilegien von Superreichen haben auch gravierende Konsequenzen für die Staatskassen. Weltweit stammen heute rund 44 Prozent der Steuereinnahmen aus Verbrauchssteuern, während die Steuern für Unternehmen nur etwa 14 Prozent und auf Vermögen nur vier Prozent ausmachen.
Deutschland schneidet auch hier im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich ab. Seit dem Aussetzen der Vermögensteuer im Jahr 1997 ist die Erbschaftssteuer die einzige verbliebene Steuer mit Vermögensbezug und trägt weniger als ein Prozent zum gesamten Steueraufkommen bei. Auch das war früher anders: 1950 lag der Anteil von vermögensbezogenen Steuern noch bei zehn Prozent. Allein durch die seit 1997 ausgesetzte Vermögensteuer sind Deutschland bis heute schätzungsweise 400 Milliarden Euro an Steuereinnahmen verloren gegangen. Aktuell würde sie mehr als 30 Milliarden Euro jährlich einbringen. Und das Potenzial ist weitaus größer: Würde Deutschland dem Beispiel der Schweiz folgen und Vermögensteuern auf dem dortigen Niveau erheben, entspräche das jährlichen Einnahmen von 73 Milliarden Euro.
Stattdessen trägt eine durch erhebliche Einflussnahme von Interessengruppen dominierte Steuerpolitik im Interesse der Superreichen dazu bei, die Kluft zwischen Arm und Reich zusehends zu vergrößern.
Reichtum und Macht
Reichtum geht Hand in Hand mit politischer Macht, beschreibt der Oxfam-Bericht die Folgen von Ungleichheit für die Demokratie. Die Superreichen sorgen gezielt dafür, dass die ungerechten Strukturen stabil bleiben: Die wirtschaftlich starken Länder im Globalen Norden bestimmen weiterhin die Regeln, von denen Superreiche und ihre Konzerne profitieren. Sie dominieren Institutionen wie den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank sowie die Finanzmärkte. Damit wächst auch ihr Einfluss auf die Steuergesetzgebung. Die Senkung von Unternehmenssteuern, unzureichende Besteuerung von Kapitalerträgen, Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer und die Abschaffung von Vermögenssteuern sind die Folge.
Oxfams Forderungen an die kommende Bundesregierung
Die zunehmende Macht von Superreichen und Konzernen verschärft die soziale Ungleichheit und ist eine Gefahr für die Demokratie. Um sie einzudämmen, seien entschiedene politische Maßnahmen nötig. Es gilt Superreiche wieder stärker in die gesellschaftliche Verantwortung zu nehmen und sie endlich angemessen zu besteuern. So können die für die Bekämpfung von Armut und Ungleichheit so wichtigen Investitionen in soziale Gerechtigkeit, die Gleichstellung der Geschlechter und den Klimaschutz hier und weltweit gestemmt werden. Unabdingbar ist es zudem, die Marktmacht von Konzernen zu beschränken, um ihren immensen Einfluss und den ihrer Besitzer*innen zurückzudrängen. Wir gehen davon aus, dass keiner dieser Punkte auf der Agenda des Blackrockkanzlers steht.
Oxfam leistet mit seinem jährlichen Reichtumsbericht anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos einen wichtigen Beitrag dazu, die Ungleichheit der Reichtumsverteilung auf der Welt in das Licht der Öffentlichkeit zu zerren. Der obszöne Reichtum, den Milliardärinnen und Milliardäre jedes Jahr immer schneller anhäufen, bliebe ja sonst ganz im Verborgenen, ganz im Interesse der scheuen Kapital-Rehlein. Auch die Forderungen, die Oxfam stellt, um die Verteilung des Reichtums zu steuern und gerechter zu machen, weisen im Rahmen des bestehenden weltweiten Kapitalismus in die richtige Richtung. Allein, es bleibt die Frage, wie sollen die Forderungen umgesetzt werden, woher soll die Gegenmacht kommen?
Die Arbeiterklasse, die das sein könnte, ist gespalten und hat ihr Klassenbewusstsein verloren, sie ist zurzeit ein Nichts. Die Lebensumstände, verschwundene Solidarität und nicht zuletzt die Macht der Medien, auch der öffentlich-rechtlichen, haben da maßgeblich dazu beigetragen; von den sog. „sozialen“ Medien ganz zu schweigen. Die „sozialen Plattformen“ sind eine wachsende Bedrohung auch für bürgerliche Demokratien, weil sie rechtspopulistische oder extreme Positionen bevorzugen und Wahlen massiv beeinflussen können. In Deutschland hat Musk seine Freunde von der AfD im Wahlkampf unterstützt und ihnen gehörig Schützenhilfe geliefert. Das wird in Zukunft sicherlich zunehmen.
Rechte Parteien finden ihre Anhängerschaft in allen Schichten der Bevölkerung, doch in der Arbeiterschaft stoßen sie auf überdurchschnittlich große Sympathie. Die AfD erhält unter den Gewerkschaftsmitgliedern prozentual mehr Wählerstimmen als in der Gesamtbevölkerung. Und die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder, die AfD gewählt haben, ist auch bei den letzten Bundestagswahlen weiter gewachsen.
Wie die Regierungsbildung in den USA zeigt, gehen die Entwicklungen in eine ganz andere Richtung als von Oxfam angemahnt und für die Weltgesellschaft nötig.
Das Kapital schafft sich den Staat, der ihm die besten Bedingungen zur Profitmaximierung gewährt. Diese Tatsache war vor nicht allzu langer Zeit bis in sozialdemokratische Kreise Allgemeingut. Allerdings hatten sich die Vertreter der Kapitalfraktionen mehr oder weniger dezent im Hintergrund gehalten und die Arbeit ihren Lobbyisten überlassen. Seit Trumps erster Amtszeit änderte sich das grundlegend. Despoten wie Bolsonaro in Brasilien und Milei in Argentinien treten in der Öffentlichkeit unverhohlen mit neoliberalen Programmen auf und werden in die Regierung gewählt; Wähler und Wählerinnen sind von ihrer Lebenssituation und dem Establishment enttäuscht und erhoffen sich Verbesserung. Wie war das nochmal mit dem Bock als Gärtner?
Das Kapital hat sein Klassenbewusstsein nicht verloren. Ein Beispiel ist der Börsenspekulant Warren Buffett, der den Krieg der Reichen gegen die Armen wiederholt benannt hat. Der „New York Times“ sagte er 2006: „Es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt, und wir gewinnen.“
Schlägt die Quantität des Reichtums in eine neue „Qualität“ der politischen Macht um?
Bei Donald Trumps Amtseinführung saßen die reichsten und mächtigsten Männer der USA in der ersten Reihe. Das veranlasste die Monitor-Redaktion zu dem Beitrag: Macht der Tech-Milliardäre: Angriff auf die Demokratie, der am 23.1. gesendet wurde. Hier einige Aussagen aus der Sendung:
„Bei der Amtseinführung von Donald Trump demonstrierten die Chefs der Tech-Giganten X, Meta, Google und TikTok ihre Nähe zum US-Präsidenten.
Musk und Zuckerberg sind zwei der Tech-Milliardäre, die sich früher eher liberal gaben. Zuckerberg sperrte einst sogar Trumps Facebook-Konto. Zu der Riege gehört auch Amazon-Chef Jeff Bezos, seit elf Jahren Eigentümer der „Washington Post“. Jetzt hat die Zeitung den Abdruck einer Karikatur verweigert, die Bezos und andere beim Kniefall vor Trump zeigt.“
Constanze Kurz vom Chaos Computer Club meinte:
„Elon Musk gehört zu Trumps Team. Mit seiner milliardenschweren Plattform X will er sich keinen Regeln mehr unterwerfen. Stattdessen die eigenen Regeln durchsetzen. Mit X macht er Wahlkampf für rechte und rechtsextreme Parteien – in Italien, Großbritannien und in Deutschland. Spätestens jetzt sollten alle Alarmglocken schrillen.“
Claus Leggewie, Politikwissenschaftler an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, führt dazu aus: "Was wir beobachten, ist das Umkippen einer Demokratie in eine Plutokratie. Die Direktherrschaft der Superreichen, die nicht etwa nur Hintenrum ihren Einfluss geltend machen, sondern die tatsächlich direkt nach der Macht greifen."
So hat der US-amerikanische Präsident dem Tech-Milliardär Musk den Auftrag gegeben, die Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst der USA auf Effektivität zu durchforsten. Das Team von Milliardär Musk, mit der Bezeichnung DOGE (Department of Government Efficiency), überprüft eine US-Behörde nach der anderen und treibt massenhafte Entlassungen von Staatsbediensteten voran. Dieser Aufgabe kommt Musk, ohne Rücksicht auf Verluste und ohne sich an arbeitsrechtliche Vorgaben zu halten, nach. In einem besonders delikaten Fall wurden 300 Mitarbeiter der US-Atomsicherheitsbehörde gefeuert. Sie wachen über den Bestand von US-Atomraketen, sind für die Wartung und Sicherung zuständig und beaufsichtigen auch den Bau neuer Nuklearwaffen. Die NNSA ist auch damit befasst, Terroristen und „Schurkenstaaten“ daran zu hindern, sich waffenfähiges Plutonium zu beschaffen. Diese Kündigungen wurden inzwischen wieder zurückgenommen. Aber der Fall zeigt: der Willkür sind Tür und Tor geöffnet, ohne Rücksicht auf geltende Rechte und Gesetze. Auf einer Konferenz der US-Konservativen hat sich Musk für seine radikalen Stellenstreichungen feiern lassen. Unter dem Jubel der Anwesenden schwenkte er eine Kettensäge durch die Luft – ein Geschenk des argentinischen Präsidenten Javier Milei. „Das ist die Kettensäge für die Bürokratie“ zitieren die Nürnberger Nachrichten Musk, der ein enger Berater von Präsident Trump ist.
Ein weiterer Milliardär und Strippenzieher hinter Trump ist Peter Thiel. Er steht politisch weit rechts, hält sich aber im Gegensatz zu Musk eher im Hintergrund. Als ein Gründer von PayPal und Investor hat er sich ein Milliardenvermögen erworben und J.D.Vance im Wahlkampf massiv unterstützt. „Thiel bekennt sich zum Libertarismus – einer politischen Philosophie, die persönliche Freiheit über staatlichen Einfluss stellt –, während er gleichzeitig die Politik des freien Marktes ablehnt, da freier Wettbewerb Profite senke. Er lobt die Praxis, Behörden gegenüber zu lügen, um sich deren Einfluss zu entziehen, da aus seiner Sicht „Firmen über Staaten“ stünden. Unternehmen würden besser geführt als Regierungen, weil an ihrer Spitze ein alleiniger Entscheider mit annähernd diktatorischer Vollmacht steht, der keiner demokratischen Legitimation bedarf. Aus ähnlichen Gründen sieht er das Frauenwahlrecht kritisch. Thiel werden Kontakte zur neoreaktionären Bewegung (NRx) nachgesagt. https://de.wikipedia.org/wiki/Marktwirtschaft
Thiel schwebt eine Herrschaft von Eliten vor, eine oligarchische Diktatur, die nur auf den Eigennutz der Herrschenden ausgerichtet ist und sich vom Gemeinwohl verabschiedet. Freiheit und Demokratie hält Thiel für unvereinbar.
Die Wirtschaftsjournalistin Christine Kerdellant ist der Macht der Superreichen in ihrem Buch „Milliardäre, die mächtiger sind als Staaten“ nachgegangen. Sie kommt zu dem Ergebnis: „Eine Handvoll Männer entscheidet nun über unsere Zukunft. Bill Gates regiert das weltweite Gesundheitswesen. Elon Musk kappt den Internetzugang der ukrainischen Armee, wenn er sie am Handeln hindern will. Mark Zuckerberg schürt den Populismus und gefährdet eine Generation von Teenagern. Jeff Bezos will uns in riesigen Kapseln in Schwerelosigkeit leben lassen. Sergey Brin und Larry Page bereiten die Verschmelzung von Mensch und Maschine vor, um dem Tod ein Ende zu setzen. Und während sie unsere Kinder zu Social-Media-Süchtigen machen, erziehen sie ihre eigenen Sprösslinge fernab von Bildschirmen, um deren geistige Gesundheit zu erhalten.
Die Internet- und KI-Milliardäre haben riesige Vermögen angehäuft, die sie mithilfe von Steuerparadiesen optimiert haben, und sind mächtiger als Staatsoberhäupter geworden. Sie sind niemandem Rechenschaft schuldig und akzeptieren nicht, dass ihren Träumen Grenzen gesetzt werden. Sie entscheiden nun allein über die Zukunft der Welt.“
Die beschriebene Macht der Milliardäre geht einher mit einem Aufschwung der politischen Rechten in den USA und in Europa. Frank Deppe geht dem in einem Aufsatz mit dem Titel „Autoritärer Kapitalismus, Der Aufschwung der politischen Rechten in den Kapitalmetropolen des Westens“ nach. In der Septembernummer der „Zeitschrift für marxistische Erneuerung Z“ des letzten Jahres schreibt er: „In der gegenwärtigen Periode vollzieht sich mit dem Anwachsen der rechtspopulistischen antidemokratischen Kräfte (einschließlich profaschistischer Tendenzen) eine Verschiebung zum autoritären Kapitalismus, der – zu Lasten demokratischer Politikgestaltung – den Primat der äußeren und inneren Sicherheit anerkennt, Disziplin nach Innen durch die Konfrontation mit den äußeren Feinden (Russland und China), durch die ideologische Aufwertung des Nationalismus und der christlichen Religion, vor allem aber durch repressive Maßnahmen gegen Ausländer und Migranten erzwingen will. Das „kriegstüchtige“ Volk muss sich den durch den Staat definierten Zielen der Selbstverteidigung gegen die Feinde von außen und innen unterordnen. …
Damit ein durch Wohlstand und Frieden verwöhntes Volk „kriegstüchtig“ gemacht wird, erfahren die ideologischen Staatsapparate (Medien, Wissenschaftssystem) eine gewaltige Aufwertung.“
Genau das findet gerade statt. Über alle Kanäle wird uns von den Medien eingetrichtert, dass es keine Alternative zu Rüstung und Kriegstüchtigkeit gibt, denn dass Russland die NATO in einigen Jahren angreifen wird, scheint nach Meinung der „Expert*innen“ ausgemachte Sache zu sein. Woher die sogenannten „Sachverständigen“ diese Gewissheit nehmen, sei dahingestellt. Aber es zeigt Wirkung. Nach dem neuesten ZDF-Politbarometer befürworten rund drei Viertel der Deutschen deutlich erhöhte Finanzmittel für die Bundeswehr, auch wenn dies die Verschuldung massiv steigert. Es ist also davon auszugehen, dass uns in Deutschland zumindest verbal kriegerische Zeiten ins Haus stehen.
Hier sei noch auf die Kampagne „Friedensfähig statt Erstschlagfähig“ hingewiesen. Darin haben sich 40 Gruppen der Friedensbewegung zusammengeschlossen. Ihr vorrangiges Ziel ist es zu versuchen, die Stationierung von Mittelstreckenraketen 2026 zu verhindern.
Das Zitat von Frank Deppe bezieht sich aber nur auf einen Teilbereich der kapitalistischen Entwicklung. Eine wesentliche Folge der Verschmelzung staatlicher
Macht des ideellen Gesamtkapitalisten mit den Partikularinteressen einzelner Superreicher ist die Dauerkrise des bürgerlichen Systems und seiner Institutionen.
Deppe spricht deshalb von einer „strukturellen Überforderung des Nationalstaats, die in Zeiten der Polykrise allerdings darin besteht, dass er den Anforderungen des Krisenmanagements nicht gewachsen ist. Er will (bei hoher Staatsverschuldung) im Interesse der Wirtschaft Wachstum, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit fördern, den Umbau zu einem „grünen Kapitalismus“ vorantreiben, die kaputte Infrastruktur (Verkehr, Gesundheit, Bildung) reparieren, die sozialen Sicherungssysteme angesichts der demographischen Entwicklung (Belastung der Rentensysteme) schützen und die steigenden Kosten der Migration, der Armut und der Prekarität übernehmen und – bei Beibehaltung der „Schuldengrenze“ – die Ausgaben für Militär und Rüstung (einschließlich der militärischen Unterstützung der Ukraine und der israelischen Armee) drastisch steigern. … Der Nationalstaat ist als Krisenmanager im Inneren gefordert und ist dabei strukturell überfordert, was sich u.a. in der hohen Staatsverschuldung sowie in der Auseinandersetzung um die sog. „Schuldenbremse“ manifestiert.
Eine funktionierende Infrastruktur entscheidet nicht nur über die Lebensqualität der arbeitenden Bevölkerung, sondern auch über die Qualität des „Standorts“, d.h. über die Verwertungsbedingungen und über die Wettbewerbsfähigkeit des Kapitals“.
So vermag der Einfluss der reichsten Männer und der wenigen Frauen unter ihnen,
ihres Kapitals, ihrer Verbindungen und ihrer verqueren, zutiefst reaktionären Überzeugungen die Funktionsweise bisher gesicherter, „stabiler“ Staatssysteme zu gefährden und damit die Lebensentwürfe von Millionen und Abermillionen Menschen in die Tonne zu treten. Das ist der wahre Skandal dieses Systems, das es zu bekämpfen gilt.
Weniger Umverteilung. Warum der Sozialstaat schlechter vor Armut schützt – für 60 Prozent der Erwerbspersonen passiert zu wenig
Eine neue Studie der Hans-Böckler-Stiftung macht deutlich, dass „Deutschland bei der Bekämpfung von Einkommensungleichheit und Armut nachgelassen hat. Zwar wirken sowohl das Steuersystem als auch der Sozialstaat in Richtung sozialer Ausgleich, doch im Zeitverlauf weniger stark als in früheren Jahren. Dabei ist der Wunsch nach staatlicher Umverteilung in der Bevölkerung weit verbreitet: Rund 60 Prozent der Erwerbspersonen finden, dass der Staat zu wenig gegen soziale Ungleichheit tut, nur rund 15 Prozent sehen das dezidiert anders.“ Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung „Weniger Umverteilung. Warum der Sozialstaat schlechter vor Armut schützt“ vom Februar 2025.
Die 2010er Jahre hätten eigentlich gute Voraussetzungen geboten, weniger Ungleichheit zu erreichen und Armut zu verringern – doch trotz des jahrelangen Wirtschaftswachstums und relativ geringer Arbeitslosigkeit haben Einkommenskonzentration und Armut in dieser Zeit zugenommen, konstatieren die Studienautor*innen Dr. Dorothee Spannagel und Dr. Jan Brülle. Daher müsse dieser Zeitraum, in dem zunächst Union und FDP die Regierung stellten, dann die Union und die SPD als kleinere Koalitionspartnerin, insgesamt als „verlorenes Jahrzehnt“ im Kampf gegen Armut und Ungleichheit betrachtet werden. (…) Ein genauerer Blick auf die Daten zeige, so Spannagel und Brülle, dass „vor allem wohlfahrtsstaatliche Leistungen in ihrer armutsschützenden und ungleichheitsreduzierenden Wirkung nachgelassen haben“. So blieb beispielsweise die Entwicklung der Regelsätze des ALG II im Untersuchungszeitraum bis 2021 deutlich hinter der Lohnentwicklung zurück und verharrte vielfach auf einem Niveau, das unterhalb der Armutsschwelle liegt. Auch die staatliche Rente wirkt heute weniger stark gegen Ungleichheit und Armut als früher, was die Forschenden auf eine Kombination aus sinkendem Rentenniveau und fehlender Mindestsicherung im Alter zurückführen. Aufgrund von brüchigen Erwerbsbiografien, Unsicherheiten auf dem Arbeitsmarkt und Niedriglöhnen müssten mehr Menschen mit geringeren Rentenansprüchen auskommen. Für die zunehmende Anzahl der Menschen, die nicht auf ausreichende Leistungen der Sozialversicherungen zurückgreifen können, seien die bestehenden Grundsicherungsleistungen systematisch zu niedrig, um Armut zu verhindern, so das Fazit. (WSI-Pressemitteilung vom 11, Februar 2025)