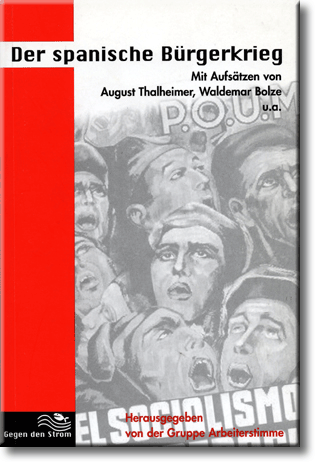Die Sozialministerin Bärbel Bas orakelt von der Einbeziehung der Beamten in die Gesetzliche Rentenversicherung. Die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche bringt einen weiteren Anstieg des Rentenalters (über 67 Jahre hinaus) ins Spiel. Laut Koalitionsvertrag soll eine Kommission bis Mitte der Legislaturperiode (das wäre etwa Anfang 2027) Vorschläge für eine „Rentenreform“ erarbeiten. Konkrete Entscheidungen sind zwar noch nicht gefallen, aber in der Zukunft ist mit Veränderungen, real wohl Verschlechterungen, bei den Renten zu rechnen. Zu diesem Thema hat uns folgende Zuschrift eines Lesers und gelegentlichen Autors erreicht.
RENTENPOLITIK: Klassenfragen enden nicht nach 67 Lebensjahren
Seit Bildung der Regierungskoalition von CDU/CSU und SPD werden Stimmen wieder lauter, Beitrage für die sozialen Sicherungssysteme „zukunftssicher“ festzuschreiben oder aber bislang gewährte Leistungsstandards abzusenken. Denn als zentral kassierte zwangssolidarische Lohnbestandteile bilden die Beitrage ein Drittel der jeweiligen Lohnhöhe und schmälern bei weiterem Zuwachs die Gewinnsituation der Betriebe. Das meint die Rede vom drohenden Verlust der „Wettbewerbsfähigkeit“. Dass diese beständige Klage über die „Abgabenlast" verunsicherte Haltungen bei der Masse der Lohn- und Gehaltsbezieher bewirkt, belegt eine erneute Umfrage von Infratest Dimap: „Aktuell sehen 49 Prozent Bedarf für eine grundlegende Reform der gesetzlichen Rentenversicherung, während 36 Prozent 'gezielte Anpassungen' wünschen. Nur elf Prozent finden: Alles 'sollte so bleiben', wie es ist." Insgesamt haben 81% der Befragten kein Vertrauen in die Bundesregierung, notwendige Maßnahmen einzuleiten, damit die Rentenversicherung „zukunftssicher“ ist. (1)
Aus dieser Verunsicherung und Unkenntnis der Finanzierungsbasis resultieren dann vorschnelle Einfälle, irgendwie weitere Geldquellen für die Rentenversicherung aufzutun, um das ohnehin bereits abgesenkte Rentenniveau festzuhalten. Vielleicht hat die neue zuständige Arbeits- u. Sozialministerin Bas (SPD) nach Ratschlägen von kompetenter Seite dazugelernt, wenn sie nicht mehr öffentlich vorschlägt, dass auch Beamte, Selbständige,·ja selbst Parlamentsabgeordnete in die Rentenversicherung einzahlen sollen, um mit mehr Geldzuflüssen insbesondere die Rentenansprüche wachsender Ruheständlermassen von derzeit 21,4 Millionen in Deutschland erfüllen zu können.
Dass mit weiteren Berufsgruppen alsbald dann zusätzliche Ansprüche an die Rentenkasse eintreten würden oder ihrer Bedienung harren, bleibt völlig aus dem Blick und verweist auf die vordergründige Absicht, mit simplen Formeln von tieferliegenden Ursachen der Rentenproblematik abzulenken.
Denn es waren beschäftigungspolitische Eingriffe, die zu einer Verzerrung der Struktur des gesellschaftlichen Gesamtarbeiters führten und dann Beitragsausfälle zeitigten, die nicht auf zu wenig Lohnarbeit leistenden Beitragszahlern beruhten, sondern auf verringerten Beitragszahlungen von in Teilzeit genötigten Beschäftigten; dies überwiegend Frauen. Hier mit einer egalitären zeitgemäßen Organisation der gesellschaftlichen Arbeit nach über hundert Jahren 8-Stunden-Tag anzusetzen, kommt etablierter bürgerlicher Politik naheliegend nicht in den Sinn, denn es würde die Arbeitskraft wieder allgemein teurer machen, nachdem Tarif- wie infolge Sozialpolitik nach 1980 darauf zielten, Lohnzahlungen eng am Produktivitätsfortschritt zu halten, aber doch wenigstens in weniger qualifizierten Berufsfeldern auch mit minimierten Sozialbeiträgen zu verringern. Das machte dann nach 2010 einen gesetzlichen Mindestlohn unausweichlich, denn in vielen Dienstleistungsbereichen waren tarifliche Verbesserungen aufgrund gewerkschaftlicher Schwäche nicht mehr durchsetzbar.
Wozu brauchen Leute, die in der Regel nicht mehr besitzen als ihre Arbeitskraft, einen Arbeitskontrakt? Gegen Lohn oder Gehalt vermieten sie quasi ihre Arbeitsfähigkeit zu bestimmten Bedingungen gegen Entgelte eines "Beschäftigers", geben vorher "Arbeit", genauer Arbeitsleistung, her. Je nach abgeforderter Arbeitsverausgabung dient das monatliche Entgelt der Reproduktion der Arbeitskraft, wozu nach gesellschaftlichem Standard passable Unterkunft, Ernährung, Bekleidung, Mobilitätskosten und nicht zuletzt der Aufwand für Kinderaufzucht gehören. Allein schon bei gesundheitlicher Versorgung, die bei Klinikaufenthalten sehr teuer werden kann, springt bei uns eine solidarisch erbrachte Kostenübernahme seitens der gesetzlichen Krankenkasse ein, deren Summe einen „beitragsfreien" Lohnabhängigen umgehend finanziell ruinieren konnte. Nicht aber den Solidarfonds einer Krankenkasse mit Millionen Mitgliedern.
Mit zunehmendem Alter, spätestens ab dem siebten Lebensjahrzehnt ist dann auch generell ein Zeitpunkt erreicht, wo vorherige Leistungsfähigkeit schwindet oder aussetzt. Doch womit oder wovon leben, wenn altersbedingt kein Arbeitskontrakt in Frage kommt? Als weitere sozialstaatliche Errungenschaft ist eine an der Lohnentwicklung orientierte Altersrente in Deutschland inzwischen von nur noch 48% des Durchschnittsverdienstes nach 45 Beitragsjahren zugesagt. Sie soll eine Lebensführung oberhalb der Armutsgrenze gewährleisten oder sogar einen erreichten Lebensstandard sichern. Nachdem jeder Lohn- oder Gehaltsempfänger bis zum letzten Monat vor dem Übergang in den Rentnerstatus - in der Gesamtheit von Lohnempfängern als Klasse, eben nicht von Generationen - seinen Rentenbeitrag abbuchen ließ, stehen dann die verbleibenden und nachrückenden Lohnabhängigen für seinen Rentenanspruch ein, der sich nach Dauer und Hohe vormaliger Einzahlungen bemisst. Im Jahre 2023 umfassten die Ausgaben der Deutschen Rentenversicherung (DRV) 374 Milliarden Euro; pro Monat dann etwa 31,2 Milliarden Euro, die aufzubringen sind. 288 Mrd. Euro waren von Beitragen gedeckt, sodass ein Bundeszuschuss von 86 Mrd. Euro aus allgemeinen Steuermitteln für den nicht einbringbaren Rest aufkam. (2) Dies nützt nicht nur den Rentnern, sondern vermeidet höhere Beitrage dann eben höherer Bruttolöhne, um die Bilanzen der privaten wie öffentlichen Betriebe zu „entlasten“, anders gesagt Schonung der Gewinn- oder Ertragssituation der Betriebe.
Wiederholte Äußerungen aus "sozial"-demokratischer Richtung, weitere Berufsgruppen in die GRV einzubeziehen, verkennen die Tatsache diverser Einkommensarten oder -bezüge mit Besonderheiten wie dann bei den Beamten: Als Amtsperson unterstellt und erwartet von ihnen der Staat ein beiderseitiges Treueverhältnis, somit Verlässlichkeit für das Privileg höheren Gehalts sowie der Alterspension, wovon jedoch höhere Beitrage f'ür eine private Krankenversicherung abgehen. Jeder Verfassungsrichter dürfte Eingriffe zur Statusminderung der Beamten verwerfen. Darauf verlässt sich letztlich dann auch der Beamtenbund. Denn wem nützt die Zunahme von Korruption im Beamtenapparat, wenn Treuebruch nicht wie bisher mit Entzug sämtlicher erworbenen Versorgungsansprüche geahndet würde?
Dass unter Selbstständigen wie Kioskbetreibern, Taxifahrern oder prekär entlohnten "freien" Journalisten keine Großverdiener zu finden sind, sollte jeder wissen. Neben der Möglichkeit punktueller freiwilliger Beitrage in die GRV könnte ein weiterer Versicherungszweig vor der Grundsicherung im Alter (Sozialhilfe unter Ausschluss von Zuverdienst) bewahren. Jedoch sind stetige Jahresbeiträge von mehr als 1000 Euro von diesen Berufsgruppen kaum zu erwarten, während "besserverdienende“ Gruppen wie Ärzte, Anwälte o.a. auf ihre eigenen Versorgungswerke zählen können.
Da sie alle, wenn nicht angestellt, nicht fremdbestimmt lohnabhängig beschäftigt sind, hat ihr Einkommen keinen Bezug zur Finanzierungsbasis der auf Lohn basierten gesetzlichen Solidarsysteme.
Jegliche aktuelle Debatte umgeht daher die einzige Verbesserung der GRV- Beitragssituation durch Ablenken von der Notwendigkeit höherer Lohnzahlung: Sei es durch Anhebung der Beitrage prozentual oder Ausweitung der Vollzeitbeschäftigung in gesellschaftlicher Breite: Der außer Acht geratene Kampf um kurze Vollzeit für alle durch den 6-Std.-Tag·in einer 30 Std.-Woche hat mit einzugehen in den Kampf' um die Zukunft des Sozialstaates.
Keine Kampfaufgabe für den DGB im Fahrwasser der SPD. Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi belässt es beim Appell an die Regierung zu "Steuererhöhungen, um etwa die Rentenkasse zu stützen". Der sogenannte Druck der Straße scheint hier nichts als tabuisiert. Mag so etwas geschehen in Nachbarländern wie Frankreich oder Belgien. Deutsche Untertanen, selbst noch mit unter sechs Millionen Mitgliedern gewerkschaftlich organisiert, haben immer zu spät aufzuwachen.
Versuche, Anteile der monatlichen Netto-Entgelte zur privaten Ergänzung der Altersvorsorge in Verwaltung der Finanzkonzerne einzukassieren, haben von dort aus nicht nachgelassen. Welch sicheres profitables Geschäftsfeld, dem die GRV noch den Zugriff auf Nettolohnbestandteile entzieht, wo das Ausbremsen der Bruttolöhne längst schon gelingt.
Allein die Nachfrage nach Risikokapital macht bei "privater" Vorsorge große Hoffnungen."Eine Schlüsselrolle spielt dabei das Rentensystem. Der Deutsche Bank Chef Sewing rechnet vor: 'Wenn die deutschen Sparer zum Beispiel analog zum Schwedischen Modell zwei Prozent ihres Bruttolohns in eine kapitalgedeckte Altersvorsorge einzahlen würden, wären allein das jährlich 40 Milliarden Euro an Investitionsmitteln'“. (4)·Norbert Rollinger, Vorstand bei der genossenschaftlichen R+V-Versicherung, sieht das weitaus skeptischer. „Viele Experten erachten Investitionen in ETFs und Aktien für sinnvoller – wegen der höheren Renditechancen. Ich halte nichts davon, dass die Bundesregierung auch Produkte ohne Garantien in der Ansparphase fördern will, um die Chancen an den Kapitalmärkten besser zu nutzen. Es geht hier nicht um Vermögensmehrung für Besserverdienende, sondern um Altersversorgung für das Gros der Bevölkerung. Deshalb braucht es einen gewissen Schutz für die eingezahlten Betrage.“ ... „Die Frühstartrente soll in ein kapitalgedecktes Altersvorsorgedepot fließen. Da werden Versicherungen eher keine Rolle spielen. Die Regierung lässt sich zu stark von der guten Entwicklung an den Börsen blenden. Bei der Altersvorsorge ist es aber nicht sinnvoll, sich mit ETF-Sparplänen komplett den Risiken des Kapitalmarkts auszusetzen. Das gilt besonders in Zeiten, in denen selbst Länder wie die USA überlegen, ob sie ihre Staatsanleihen künftig noch bedienen können oder wollen. Die Risiken an den Märkten sind so groß wie lange nicht."·(5)
Die in diesen Zitaten genannten wenigen Fachbegriffe verweisen für Außenstehende auf einen Wirrwarr von Lockangeboten und intransparenten Vertragsfallen, mit denen bei ergänzender individueller Altersvorsorge zu rechnen ist. Dauerhaftes Einstreichen von Provisionen und Verwaltungsgebühren für das Beibringen von Dividendenanteilen des Kapitaleinsatzes ist den Finanzagenten dabei sicher. Um gewerkschaftliche Positionen gegen das Schlechtreden der GRV zu stärken, wäre es hilfreich, wenn gewerkschaftliche Aktivisten Vortrags- wie Diskussionsabende initiieren würden, bei denen auch Sprecher der regionalen Rentenberatungsstellen auftreten können. Mehr Einsicht in die Rentenfinanzierung ist die Voraussetzung, um in öffentlicher Aktion entschieden für sichere gesetzliche Renten einzutreten.
Leichtfertige wie kurzsichtige Sprüche wie „alle sollen da einzahlen" gehen am Verständnis der Finanzierung unserer sozialen Sicherungssysteme vorbei.
H.Z., Go. 14.8.25
1) Die Welt, 8.8.2025
2) Bei gleichem Normalarbeitstag von 6 Stunden und 50 Arbeitswochen pro Jahr bei 40 Millionen Beschäftigten reicht eine 30 Stundenwoche hin, 60 Milliarden Arbeitsstunden zu erbringen. Ein Durchschnittsverdienst von 4000 Euro bei 800 Euro Rentenbeitrag führt zu 32 Milliarden Euro Einnahmen der Rentenversicherung monatlich.
3) Handelsblatt 4.8.2025
4) Handelsblatt 23./24.5.2025
5) Handelsblatt 10.6.2025